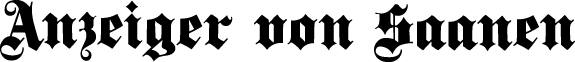Der liebe Gott und die Übel der Welt
27.10.2017 Gsteig, KircheWenn Gott diese Welt geschaffen hat, möchte ich nicht dieser Gott sein, denn das Elend der Welt würde mir das Herz zerreissen.
ARTHUR SCHOPENHAUER
BRUNO BADER
Wie kann Gott zulassen, dass Krankheiten, Unrecht und Gewalt das Gesicht der Erde entstellen? Unterdrückung, Not und Zerstörung begleiten als dunkle Schatten die Geschichte der Menschheit und das Leben einzelner; eindringlich führen solche Erfahrungen zu den Fragen: Warum fällt Gott dem Bösen nicht in den Arm? Warum lässt er zu, was um unserer Menschlichkeit willen unzulässig ist?
Die Übel der Welt sind Argumente gegen die Vertrauenswürdigkeit Gottes. Viel steht auf dem Spiel: Ist Gott an seinen Geschöpfen nur bedingt interessiert und lässt zu, dass den einen oder anderen unverschuldet ein Leid trifft? Ist er in sich gespalten und duldet neben sich eine Macht des Bösen? Oder ist er nicht imstande, seine Interessen wahrzunehmen und seine Geschöpfe zuverlässig zu schützen? Im ersten Fall verdiente Gott nicht gütig, im zweiten nicht gerecht und im dritten nicht allmächtig genannt zu werden. Doch könnte man ihn als Gott anrufen, wenn man ihm auch nur eine diese Eigenschaften absprechen müsste?
Zwei Götter?
Das Problem liesse sich lösen, wenn wir die Vorstellung von einem Gott durch die Rede von zwei Göttern ersetzten. In diesem Fall wäre der eine für Glück, Freude und Gelingen zuständig, der andere für die Übel der Welt. Die Zweiheit von Licht und Finsternis überzeugte bereits einen Teil der ersten Christen, denn mithilfe dieser Lehre gelang es ihnen, die Erfahrung von Verfolgung und Ausgrenzung einzuordnen; der Versuch, Gott und die Welt dualistisch zu erklären, findet sich heute vor allem in esoterischen Gruppen. Die Mehrheit der christlichen Kirche freilich verweigert sich dieser Auffassung und hält in der Tradition der biblischen Schriften an der Rede von einem Gott fest.
Was nun? Wie lassen sich die Übel der Welt und der Glaube an Gott zusammenbringen? Wie kann er zulassen, dass Elend und Not über Menschen ohne deren Zutun hereinbrechen? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns zunächst darüber verständigen, wen oder was wir meinen, wenn wir «Gott» sagen. Umgangssprachlich bezeichnet dieses Wort gemeinhin ein allmächtiges, gütiges und gerechtes, gleichsam überirdisches Wesen. Zu ihm gehört es, über unbegrenzte Macht zu verfügen und jenseits der Welt zu thronen; Gefühlsäusserungen sind ihm fremd und Vollkommenheit eigen. Mit einem Wort: Ein solches Wesen verkörpert all das, was wir Menschen nicht sind. Mit den Niederungen alles Irdischen hat es nichts zu schaffen und von der Welt lässt es sich auch dann nicht berühren, wenn diese ihr hässliches Gesicht zeigt. So bleibt im Falle von Elend und Not entweder, bitter zu werden oder sich ganz von Gott zu verabschieden. In der Tat wählen in der Moderne viele den Weg des Atheismus.
Die dunklen Seiten Gottes
Die Bibel korrigiert die überkommene Vorstellung und erzählt anders von Gott. Bei einem Propheten des Alten Testamentes heisst es: «Ich bin der Herr und sonst niemand. Ich erschaffe das Licht und mache das Dunkel, ich bewirke das Heil und erschaffe das Unheil.» (Jesaja 45,7) Diese Worte bringen den Namen Gottes nicht nur mit Licht und Heil in Verbindung, sondern auch mit Unheil und Finsternis. Gott erscheint als dunkel und verborgen, ferne und geheimnisvoll, an anderer Stelle ist von seinem Zorn und seiner Rache die Rede. Diesen dunklen Seiten Gottes ist Hiob, die grosse Gestalt des Alten Testamentes, in besonderer Weise ausgesetzt: Gott lässt ihn, einen Mann ohne Fehl und Tadel, zunächst seines Besitzes, dann seiner Kinder und schliesslich seiner Gesundheit berauben. Doch Hiob zieht nicht die atheistischen Konsequenzen der Moderne und sagt sich von Gott los, sondern wendet sich ihm im Gegenteil zu und überzieht ihn mit seiner Klage. Eine Antwort auf die Frage nach Grund und Ursprung seiner Übel erhält Hiob nicht, doch er ringt um das rettende Eingreifen Gottes. Der lässt sich von seinem Geschöpf berühren, hört auf dessen Klage und stellt den Geschundenen wieder her; zuletzt bekennt Hiob: «Vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen; jetzt aber hat mein Auge dich geschaut.» (Hiob 42,5)
Die Rede vom «lieben Gott» ist, das können wir als Zwischenergebnis festhalten, irreführend und unscharf: Gemäss dem Zeugnis des Alten Testamentes ist Gott einer, der mit Dunkelheit und Unheil vertraut ist und sich den Übeln der Welt aussetzt. Seinen Geschöpfen entzieht er sich nicht, sondern lässt sich von deren Geschick bewegen.
Anders von Gott reden
Das Neue Testament nimmt diese Spur auf und führt sie weiter; ihm zufolge stellen Kreuz und Auferstehung Jesu Christi die endgültige Hingabe Gottes an seine Schöpfung dar: Der Mensch Jesus setzt sich Elend und Not aus und wird von den Mächtigen gefoltert und ohne Verschulden hingerichtet. Gott anerkennt diesen Weg als seinen eigenen, identifiziert sich mit einem zu Tode gebrachten Menschen und erträgt die Berührung des Todes. Er stellt sich als einer vor, der sich in die Übel der Welt verwickeln lässt, und jene Person, die an eben diesen zugrunde geht, ins Recht setzt, erneuert und bekräftigt.
Die Bibel leitet dazu an, klassische Vorstellungen zu überwinden und neu von Gott reden. Laut ihrem Zeugnis geht die Weltgeschichte nicht ohne Spuren an Gott vorüber, er erträgt ihre Abgründe und lässt sich durch sie verwandeln; das Kreuz – Sinnbild für Katastrophen, Verderben und Unheil – ist und bleibt in seinen Namen eingezeichnet. Herkömmliche Zuschreibungen, in der Regel verbinden wir mit Gott ein allmächtiges, überirdisches und unbewegliches Wesen, taugen nicht mehr; stattdessen ist nun von der Selbsthingabe, dem Schmerz und der Ohnmacht Gottes zu reden. Diese Erkenntnis führt zweifellos dazu, dass sich die Kluft zwischen dem Glauben an Gott und der Erfahrung von Übel zu schliessen vermag, denn sie benennt Gott als einen, dem Leiden nicht fremd und Schmerz vertraut ist. Was aber nützt das? Gewiss, wir stehen nun einem Gottesbild gegenüber, das unseren Erwartungen widerspricht. Aber sonst? Inwiefern kann ein ohnmächtiger Gott uns eine Hilfe sein? Führt die Erkenntnis seines Schmerzes gar zu einer Verdoppelung unserer Not? Oder dazu, dass diese – horribile dictu – niemals aufhört?
Das Gericht am Ende der Zeit
Sich abfinden, resignieren und sich fügen – das bedeutet die Rede vom Schmerz Gottes gerade nicht. Die Erkenntnis seiner Qual geht den biblischen Schriften zufolge einher mit den Fragen: Wie lange noch wird mich der Schmerz peinigen? Wann wird Gott sich zeigen und die Not lindern? Hat das Böse auf Dauer Bestand? Wie wird er den Opfern und Entrechteten Recht verschaffen? Mit anderen Worten: Die Erfahrung von Übel lässt die Frage nach Erlösung laut werden und hält nach der Hoffnung auf eine zukünftige Welt Ausschau, in welcher «kein Leid, kein Geschrei und keine Mühsal mehr sein wird» (Johannesoffenbarung 21,4).
Auf diese Fragen antworten das Alte und das Neue Testament mit der Rede von einem künftigen Gericht Gottes. Dieses Bild verkörpert die Hoffnung, dass Gott am Ende der Zeit Tränen abwischen und Recht sprechen wird. Das Gericht wird, so lautet die Zuversicht des Glaubens, die Täter mit ihren Untaten konfrontieren und den Opfern Gehör verschaffen; es wird zutage bringen, was verborgen und gerade rücken, was entstellt ist, es wird wieder herstellen und heilen. Mit der Rede vom Gericht antwortet die Bibel auf die Erfahrung von Übel und die Rätsel der Geschichte.
Eine billige Vertröstung?
Indes: Stellt die Hoffnung auf eine neue Welt nicht eine billige Vertröstung dar? Ist die Rede von Gericht und Zuversicht nicht bloss Augenwischerei? In der Tat war und ist sie das nicht selten. Diese Einschätzung gilt allerdings nicht für den Fall, wenn die Hoffnung auf eine gute Zukunft die Gegenwart zu gestalten weiss. Dies wiederum geschieht dann, wenn ich als einzelner oder als Teil einer (christlichen) Gemeinschaft die Geschichte Vergessener erzähle, Untaten als solche benenne oder die Gequälten und Gepeinigten aufsuche. Gewiss, auch dann noch entstellen Krankheiten, Unrecht und Gewalt das Gesicht der Erde, doch der Blick über den Horizont hinaus sowie die Haltung «Ich erwarte mehr, als ich heute zu erkennen vermag» kräftigen, stärken und ermutigen.
Die Schöpfung ist kein Paradies
Eine Frage bleibt: Woher kommen die Übel der Welt? Zweifelsohne liegen ihre Ursachen zu einem Teil bei uns Menschen, doch Unheil und Ungemach lassen sich längst nicht immer auf ein Verschulden oder Versagen zurückführen. Eine Schöpfungsgeschichte aus dem Alten Testament beurteilt das Geschaffene als «sehr gut» (Genesis 1,31), doch im Verständnis der biblischen Schriften stellt die Schöpfung zu keinem Zeitpunkt ein Paradies im herkömmlichen Sinn dar; Arbeit und Mühsal gehören zur natürlichen Ordnung der Welt, ebenso Töten und Zerstörung. Für das Alte und Neue Testament stellt der Kosmos keine heile Welt voller Harmonie dar, sondern ist durchbrochen von «Hagel und Regenflut» (Hiob 38,22.25) und kann also zu einer unwirtlichen Gegend werden. Das Universum ist nicht Gottes Puppentheater, sondern eine Arena von Improvisation und Eigendynamik – mit sämtlichen Risiken. Warum das so ist, darauf gibt die Bibel keine Antwort; die Herkunft der Übel bleibt ein Rätsel. Ihre endgültige Überwindung steht noch aus.
Wie lassen sich die Übel der Welt und der Glaube an Gott zusammenbringen? Indem die Erfahrung von Elend und Not die Frage nach Gott nicht zum Verstummen bringt, sondern zum Anlass wird, sie neu zu stellen. Leidenschaftlich und drängend.