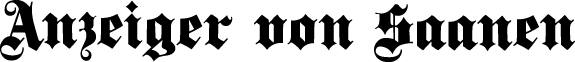Michael May – Tüftler, Ingenieur und Rennfahrer
18.04.2019 RegionPORTRÄT Turbo: Bereits das Wort evoziert Kraft! Mittels Abgasturbolader leistungsgesteigerte Motoren sind heutzutage – gerade auch wegen strengerer Abgasvorschriften – sehr verbreitet. Dies verdanken wir zwei Schweizer Ingenieuren. Alfred Büchi liess 1905 seine Turboaufladung patentieren. Bis in die 1960er-Jahre wurde diese Technik in Diesel- und Flugzeugmotoren eingesetzt. Michael May fand dann einen Weg, auch Otto- (Benzin-)Motoren mit Turbos aufzuladen. Seit 30 Jahren erholt er sich immer wieder in der lieblichen Umgebung von Gstaad. Ich habe den rüstig-vifen Herrn zu einem Gespräch getroffen.
ÇETIN KÖKSAL
Michael May wurde als Sohn eines deutschen Vaters und einer Schweizer Mutter 1934 in Stuttgart geboren. Sein Grossvater mütterlicherseits, Wilhelm Kaiser, hatte 1901 die bis heute existierende Chocolat-Manufaktur Villars in Villars-sur-Glâne gegründet. Sein Vater und dessen Vorfahren waren ebenfalls Unternehmer. Aufgewachsen ist Michael May auf der Faulenmühle im ländlichen Schwabenland in Westhausen «mit dem silbernen Löffel im Mund», wie er heute im Rückblick unumwunden eingesteht. Selbstverständlich hatte seine Kindheit mit dem Lebenswandel der heutigen Jeunesse dorée nicht viel gemeinsam, befand sich Europa doch zu jener Zeit im Zweiten Weltkrieg. Die privilegierte finanzielle Situation seiner Familie erlaubte ihm aber dennoch ein relativ ruhiges, unbeschwertes Aufwachsen auf dem Lande. Klein-Michael machte sich sogar eine während des Kriegs geltende Verordnung der Nazi-Regierung zunutze. Diese besagte, dass der älteste Sohn vom Schulunterricht befreit werden konnte, um zu Hause den Hof weiterzuführen, falls der Vater ins Kriegsgeschehen eingespannt war. Seine Eltern waren viel unterwegs und so überzeugte er die Schulleitung davon, dass er nun die Faulenmühle führen müsse. Dem war natürlich nicht so und seine Abmachung mit der Schule erfolgte heimlich ohne Wissen der Eltern, wie Michael May mir mit einem Augenzwinkern erzählte. Die so eingehandelte «Freizeit» nutzte der Knabe bereits damals mit Vorliebe zum Tüfteln in der heimischen Werkstatt.
Schweizer Schulernst und Erfindergeist
1945, nach Kriegsende, hatten Michael Mays Eltern beschlossen, dass die Mutter mit den beiden Kindern in ihre alte Heimat zieht. Vater May blieb derweil in Deutschland und Teenager Michael konnte die Schulferien weiterhin in Vaters Werkstatt verbringen. Dies obwohl er nur mühsam den Anschluss an das Schweizer Schulsystem fand. Nun, das selbst arrangierte «Freijahr» zur «Führung» der Faulenmühle hat da bestimmt nicht geholfen. Die leidige Schulzeit absolvierte Michael May mit einem absoluten Minimalaufwand und war sichtlich erleichtert, als diese Zeit nach bestandener Matura am Gymnasium Fribourg endlich ein Ende fand. Schliesslich gab es so viel spannendere Aufgaben, die gelöst werden wollten. Was unternimmt man zum Beispiel, wenn man mit einem Freund zusammen auf dem Murtensee Boot fahren möchte, ein solches aber nicht verfügbar ist? Eines kaufen lag natürlich nicht im Sackgeldbudget drin. Also bauten die beiden selber ihr ersehntes Boot. Auf einen Holzrahmen leimten sie eine acht Millimeter dicke Aussenhülle mit Zeitungspapier. Ein ausrangierter Motorradmotor wurde auf Wasserkühlung umgebaut und nach erfolgreichem Stapellauf lockten aufregende Expeditionen auf See. Als der sechzehnjährige Michael ein Kreidler-K50-Moped bekam, machte er sich natürlich gleich an dessen Optimierung. Konnte mit den serienmässigen zwei PS eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 50 km/h erreicht werden, lag der damalige Rekord bei 120 km/h. Jüngling Michael erreichte mithilfe von Direkteinspritzung mit Wasserstoffsuperoxyd-Zusatz und den gängigen Tuningmassnahmen respektable 96 km/h. Selbstredend hätte er weitergetüftelt und nach Lösungen gesucht, um den Rekord zu brechen, wenn die Ferien nicht schon wieder viel zu früh vorbei gewesen wären. Ein Jahr zuvor hatte er sich an die Konstruktion eines Drehkolbenmotors gemacht. Da das Ding auch nach zwei Jahren noch immer nicht zufriedenstellend lief, kam der noch sehr junge Michael für sich zum Schluss, dass dies ein ineffizientes Konzept sei. Heute würden ihm die meisten Motoringenieure wohl darin zustimmen. Die Produktion des letzten serienmässigen Nischenautos mit Wankelmotor, des Mazda RX8, wurde vor ein paar Jahren eingestellt. Ende der 1950er-Jahre aber glaubten auch sehr namhafte Autohersteller im Drehbzw. Kreiskolbenmotor eine effizientere Alternative zum Hubkolbenmotor gefunden zu haben. Unbefriedigende Erfahrungen – vor allem in Bezug auf Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit – liessen die anfängliche Begeisterung dann nach ein paar Jahren jäh verpuffen.
Rennfahrer und Student
Während Michael May von 1954 bis 1959 Maschineningenieur an der ETH Zürich studierte, startete er nebenbei eine ziemlich beeindruckende Karriere als Rennfahrer. Nach etwas enttäuschenden Versuchen mit einem Motorrad tauschte er dieses gegen einen Nardi-Danese 815 Sport ein. Den kleinen Strassensportwagen baute er sodann zum Rennwagen um, fuhr damit einige Schweizer Bergrennen und erwarb sich so die Rennlizenz des ACS. Sein Vetter Peter May absolvierte zu dieser Zeit ein Praktikum bei einer Zürcher Privatbank und verdiente sich mit einer Portion Glück einen saftigen Bonus. Den investierten die beiden sogleich in den Kauf eines Porsche 550 und planten ihre gemeinsame Rennzukunft. Erster Termin auf ihrem Kalender war 1956 das 1000-km-Rennen am Nürburgring. Es stellte sich nun die Frage, wie man überhaupt eine Chance gegen die potenteren Werksautos mit ihren finanziell viel grosszügiger ausgestatteten Teams hatte. Tüftler Michael May überlegte sich, dass eine signifikante Leistungssteigerung des Motors zu aufwendig war. Sollte er aber eine Lösung finden, die Kurven schneller als die anderen zu fahren, könnten sie das Leistungsdefizit wieder wettmachen. Mehr Anpressdruck, also Abtrieb war demzufolge gefragt, doch wie konnte dieser erzielt werden? Michael May liess sich von der Flugzeug-Aerodynamik inspirieren und montierte einen aus Aluminium gefertigten Flügel auf den Porsche. Durch die mittige Positionierung konnte das ausgezeichnete Handling des 550 erhalten bleiben. Da die Flügellänge durch die Fahrzeugbreite limitiert war, montierte er zudem an beiden Flügelenden sogenannte Winglets. Diese nach oben und unten gerichteten Verlängerungen reduzieren die Wirbelbildung und verbessern dadurch die aerodynamischen Eigenschaften. Es vergingen viele Jahre, bis die zivile Flugzeugindustrie anfing, mithilfe von Winglets Treibstoff einzusparen. Heute verfügen sehr viele moderne Ziviljets über diese Verwirbelungshemmer. Nun, die damals bahnbrechende Neuerung im Autorennsport bescherte den Vettern May hervorragende Trainingszeiten, waren sie doch schneller als die Porsche-Werkswagen. Dessen einflussreicher Chef, Huschke von Hanstein, erwirkte als Folge dessen ein Flügelverbot im Rennreglement, das erst Mitte der 1960er-Jahre aufgehoben werden konnte.
Businessplan Europameister
Am Autosalon Genf 1959 stand ein tiefroter Stanguellini 1100 Corsa-Junior Rennwagen für 15’000 Franken zum Verkauf. Abgeleitet vom Grossserien-Fiat 1100, konnte man damit an der damals neu ins Leben gerufenen Formel Junior teilnehmen. Michael May wollte das Objekt der Begierde unbedingt haben und machte für sich folgende Kalkulation: 7500 Franken erhielt er für seinen Nardi-Danese im Eintausch. Für die restlichen 7500 Franken unterschrieb er einen Wechsel, eine Art Schuldschein, welcher dann im August 1959 fällig wurde. Jetzt musste er nur noch Europameister werden, um mit dem Preisgeld die Schuld rechtzeitig begleichen zu können. Für den selbstbewussten jungen Mann schien das durchaus ein erreichbares Ziel zu sein und so besiegelte er den Handel voller Optimismus. Als ich Michael May während unseres Gesprächs gefragt habe, warum er mit dem Autorennsport angefangen habe, antwortete er: «Wir wollten uns schlicht amüsieren und ich wusste einfach, dass ich schneller sein konnte als andere.» Die abgelieferten Leistungen an der Formel Junior 1959 jedenfalls bestätigten diese Selbsteinschätzung. Unter anderem gewann er das prestigeträchtige Rennen von Monaco. Am Donnerstag vor dem Rennwochenende absolvierte der Student May noch Prüfungen an der ETH, fuhr dann mit einem Freund in Mutters Auto über Nacht von Zürich nach Monaco, wo er als sein eigener Mechaniker den Vergaser des Stanguellini einstellte. Alles lief wie am Schnürchen und so kehrte der Monaco-Sieger May mit dem aus den Händen von Fürstin Gracia Patricia überreichten Pokal zurück in die Schweiz. Der weitere Verlauf der Saison lief sogar so gut, dass er seinen geplanten Europameistertitel tatsächlich erreichte. Der Haken dabei war nur, dass das «erwirtschaftete» Preisgeld bei Weitem nicht ausreichte, um die noch offenen 7500 Franken zurückzahlen zu können. Wie so oft in solchen Fällen half ihm die liebe Mama aus der Patsche. Der Erfolg in der Formel Junior zog dann später eine Teilnahme an der Formel 1 mit Lotus und Porsche nach sich.
Dipl. Ing. und Forscher
Nach dem Studium arbeitete Michael May bei Daimler Benz und Porsche, wo die Rallye- und Formel-1-Rennautos mit Direkteinspritzung optimiert wurden. Dabei fiel der talentierte Ingenieur sogar dem grossen Patriarchen Enzo Ferrari auf. Nach einer Unterredung engagierte jener Michael May als Berater mit der klaren Aufgabe, die Leistung der Ferrari-Motoren zu steigern. Für die geforderten Mehr-PS wurde eine Basissumme als Entgelt vereinbart und für jede zusätzliche Pferdestärke (PS) handelte der Schweizer Ingenieur einen Bonus aus. Nach einem Jahr erfolgreicher Zusammenarbeit überreichte der Commendatore (Ferrari) seinem Berater ein stolzes Honorar von mehr als 300‘000 Franken in bar. Verstaut in einem gewöhnlichen Reisekoffer machte sich Michael May mit seiner späteren Ehefrau auf die Heimreise. Der stattliche Betrag erlaubte es den beiden, die Firma Turbo May GmbH zu gründen. Aufträge kamen unter anderem von einem Rasenmäher- und Motorsägen-Hersteller, der einen Motor suchte, welcher in jeder Lage einwandfrei lief. Mithilfe der Einspritztechnik von May konnte zudem der teure Vergaser ersetzt werden. Für Ford entwickelte die junge Firma eine Hochleistungs-Einspritzanlage für deren damaligen V6-Motor. Das Konzept funktionierte zwar sehr zufriedenstellend, war aber für die Serienproduktion zu teuer. In Erinnerung an den eingangs erwähnten Professor Büchi ging Michael May an die Entwicklung eines Turbos für Otto-Motoren. Er fand eine Lösung und so hatten mit May-Turbos aufgeladene Ford 20M RS bis zu 70 % mehr Leistung als die Serienautos. In PS ausgedrückt bedeutete dies gut 180 anstatt 108 Pferdchen. Das katapultierte die Fords schlagartig in die Fahrleistungsregionen eines Porsche 911. Die späteren Turbo-Capris galten gar als Porscheund Co-Schreck. Das führte dazu, dass der damalige Entwicklungschef von Porsche und spätere Konzernchef von VW, Ferdinand Piëch, angeblich einen Ford Capri May-Turbo kaufen liess. Plötzlich machte Porsches bis anhin problembehaftete Turboentwicklung einen so grossen Sprung, dass bald schon der erste Porsche 911 Turbo auf dem Pariser Autosalon präsentiert werden konnte. Überhaupt gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den Autoherstellern eher schwierig. Anfang der 1970er-Jahre verlor Michael May das Interesse an Turbo-Motoren und mit dem Umzug an den Genfersee flammte dafür wiederum jenes an Bootsmotoren auf. Mit seiner Einspritztechnik kitzelte er zum Beispiel aus einer Volvo-3-Liter 6-Zylinder-Maschine mehr als 600 PS heraus. Später entwickelte May unter anderem den sogenannten Fireball-Zylinderkopf für den Jaguar V12-Motor. Der danach als V12 H.E. (High Efficiency) bezeichnete Motor verbrauchte damit deutlich weniger Benzin.
Krebsprophylaxe?
Ohne jede Vermessenheit darf man, glaube ich, festhalten, dass Michael May ein Mensch ist, der grundsätzlich nach vorne schaut. Wie er mir während unseres Gesprächs mehrmals sagte, interessiert ihn selbst in fortgeschrittenem Alter vor allem das, was noch kommt. Nostalgie oder gar verklärende Rückblicke seien so gar nicht seine Sache. «Ich bin auch überhaupt nicht Kaufmann. Sobald etwas getan war und funktionierte, fing es an, mich zu langweilen und dann wollte ich weiter zu neuen Herausforderungen.» Vermarktung und – damit verbunden – eine lukrative Geschäftstätigkeit hätten ihn nie interessiert. «Abgeschlossen ist abgeschlossen», bekräftigte er. So handhabte Michael May es mit der Direkteinspritzung, dem Turbo, Fireball und der Rennfahrerei. Heute beschäftigen ihn diese Themen kaum mehr. Was ihn schon eine Weile umtreibt, ist ganz einem anderen Fachgebiet zuzuordnen. Eine Cousine von Michael May hatte einen Gynäkologen geheiratet, der die Theorie vertrat, dass ein AntihCG-Prinzip das Wachstum von bösartigen Krebszellen verhindere. Humanes Choriongonadotropin (hCG) ist das erste Hormon, das bei Schwangerschaftsbeginn von der befruchteten Eizelle produziert wird, um deren Wachstum und Einnistung zu gewährleisten. Besagte Theorie geht davon aus, dass hCG im späteren Leben ein wachstumsauslösender Faktor für Krebs sein könnte. Das Wirkprinzip der ersten «Pille danach», Mifepristone (RU-486), ist eine gegen den hCG-Effekt gerichtete Wirkung des RU-486, mit dem Ziel, einen Schwangerschaftsabbruch durch eine Menstruationsblutung auszulösen. Michael May ist nun seit geraumer Zeit intensiv darum bemüht, den Zusammenhang zwischen hCG und der Entstehung bzw. dem Wachstum von Krebs zu untermauern. Zudem versucht er nachzuweisen, dass eine prophylaktische Einnahme von RU-486 den hCG-Wachstumsstimulus blockiert und somit die Entstehung und Ausbreitung von Krebs eindämmt, wenn nicht sogar verhindert. Den unzähligen Betroffenen dieser Krankheit wünscht man inständig, dass diese von Michael May vertretene Theorie dereinst bewiesen werden kann.