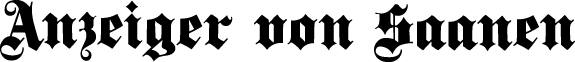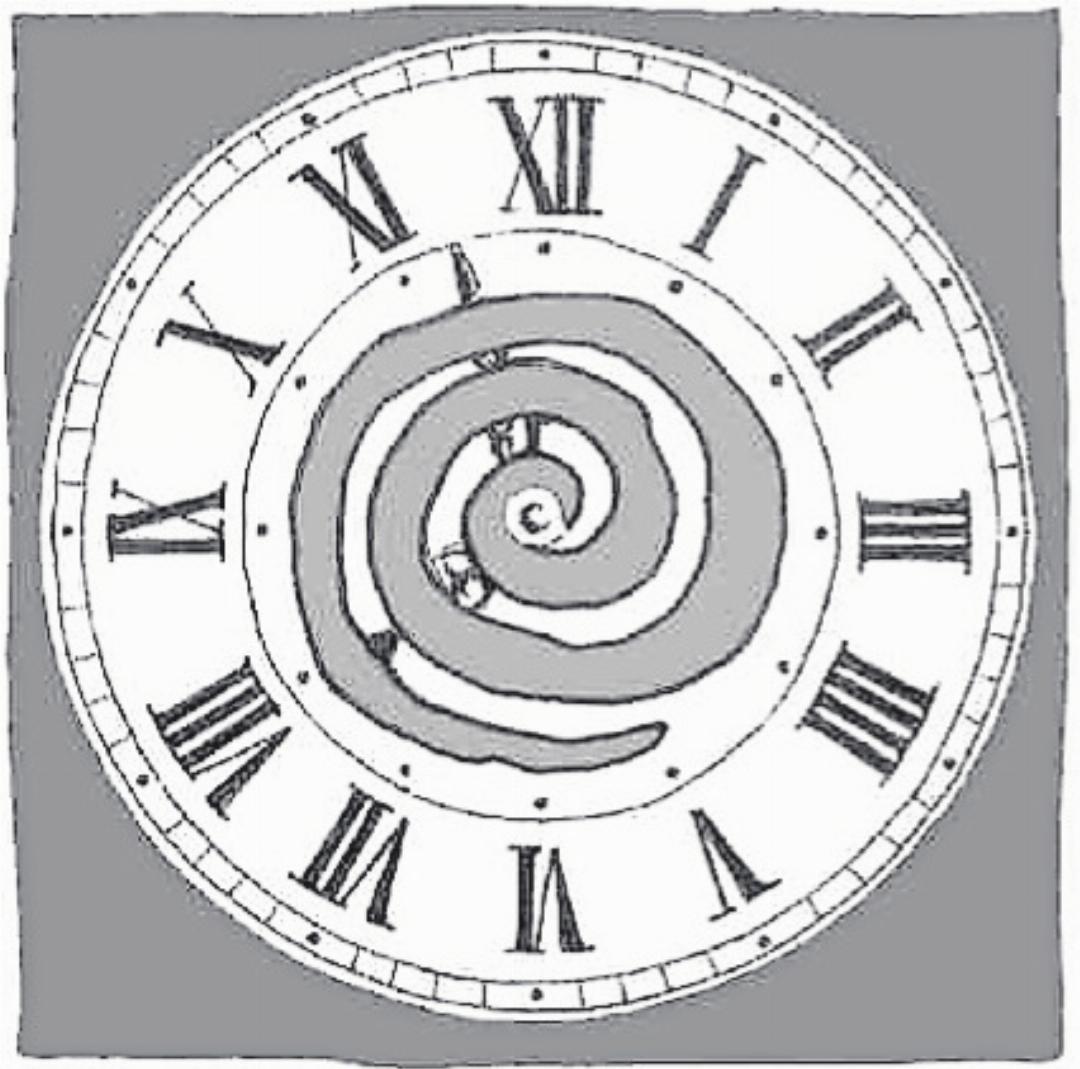Zeit. Zeiten. Wende.
29.07.2022 Kirche«Wir leben in einer Zeit vollkommener Mittel und verworrener Ziele.»
(Albert Einstein)
In der chinesischen Schreibsprache vereint die Vokabel «Krise» die beiden Zeichen für «Chance» und «Gefahr».
Krise – Gefahr
Nicht ich, sondern so sagt es «der schönste Beruhigungstext» der Weltliteratur: «Ein Jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel seine Stunde.» (Prediger 3, 1–8).
Ja gut, «Salomons Weisheit» stammt aus einer Zeit, in der sich wenig veränderte, ausser den Jahreszeiten und den Herrschern, und das Leben eingebunden war in ewige Rhythmen: des Leibes, der Reifung der Feldfrüchte, der Jahreszeiten, der täglichen Arbeit, der Feste. Poesie, die für Jahrtausende taugte, in denen ein gewöhnliches, mühseliges Leben im Umkreis von zwei Halbtagesfussmarschstrecken sich abspielte, die Bedürfnisse so überschaubar waren wie die eigenen Kräfte, und Wachstum hiess: dass Kinder wachsen, dass der Weizen wächst, dass Königreiche wachsen – und Alte sterben und der Weizen geerntet wird und die Reiche schrumpfen. Es war ein ewiger Kreislauf. Und deshalb sinnlos – oder «eitel», wie es bei Salomon heisst («alles ist eitel …») – noch mehr zu wollen; denn es war immer vom Gleichen. Hatte man ein Jahr erlebt, hatte man im Grunde alle erlebt, und noch der Tod war Teil dieser Ordnung und das Leben hörte mit ihm nicht auf. Reifen: reifen lassen. Ernte: ernten können. Säen. Wachsen … vergehen …
Und heute? Heute hat schon Geborenwerden nicht mehr «seine Zeit» – wann und wie geboren wird, darüber entscheiden zunächst wir oder die Dienstzeitpläne der Ärztinnen, Ärzte. Sterben hat nicht mehr «seine Zeit», sondern die Zeit der Intensiv- und Transplantationsmedizin. Die Zeit des Pflanzens wird von den Genetikern manipuliert, die Zeit zum Heilen wird von den Versicherungsmathematikern bemessen. Das Klagen misst der Psychiater in Teilstunden. «Suchen hat seine Zeit?» Nun, mit computergestützter Partnersuche und speeddating gehts schneller. «Herzen hat seine Zeit?» Wenn es um das Herzen der Kinder geht, heisst das auch bei uns nun: «quality time» – zwei Stunden zwischen Feierabend und Zubettgehen. «Jegliche Dinge» haben heute, im mittelständischen Mitteleuropa nicht mehr ihre Zeit, sondern die Beschleunigung teilt diktatorisch jeglichem Tun seine Zeit zu. Und es geht immer noch schneller, damit wir mehr erleben (leben?) in weniger Zeit. Und genau mit diesem Wunsch geraten wir immer stärker in Zeitnot. Beschleunigung ist ein Epochenbegriff. Beschleunigung ist die Signatur der Zeit.
Doch die Geschichte der Beschleunigung war ja aber auch eine Erfolgsgeschichte. 200 Jahre lang formte explosives Wirtschaftswachstum unsere westlichen Gesellschaften. Wissenschaft und Technik gaben uns Werkzeuge, mächtiger als alle zuvor. Der Hunger verschwand – aus unseren Breiten. Was ehedem nur Adeligen und Grossbürgern zukam, wurde, wenn auch nicht ohne Klassenkampf, zum allgemeinen Lebensstandard. Kapitalismus und Industrie, so wurde wortmächtig gepriesen, beseitigten die Not, «retteten» die Menschen aus der «Idiotie des Landlebens», wo jedes Dorf seine Zeit hatte, in die Netzwerke der Zivilisation und verfeinerten die Bedürfnisse. Nun ja, sie weiteten sie auf jeden Fall aus, die Bedürfnisse. Alle Ökonomie ist Ökonomie der Zeit. Technik und Rationalisierung verkürzen die Zeit, die wir brauchen, um ein Produkt herzustellen, und viele dieser Produkte «schenken» uns noch mehr Zeit: Die Waschmaschine hat Milliarden von Frauen Billionen von Stunden harter Arbeit erspart.
Ich empfinde jetzt eben grad wieder den Sonnenstrahl, der durch die geschlossenen Fensterläden dringt, mich in aller Morgenfrühe, den Knaben, in der Nase kitzelt – und unten in der Waschküche stampft der Waschkessel in ruhigem Takt, daneben steht meine Mutter in fester Waschschürze … Geborgenheitsgefühle! Zeit! Da war «die Welt noch in Ordnung» – wenigstens für mich.
Vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert musste ein Arbeiter vier Wochen arbeiten, um einen Kühlschrank zu kaufen, heute reichen zweieinhalb Tage oder weniger. Und bei grundlegenderen Produkten ist es nicht anders: für «Anke, Sauz u Zucker u Miuch» Bruchteile dessen, was unsere «Alten» noch aufbringen mussten. Bei all dem wurde die Zeit für die Menschen immer knapper, und sie selbst immer nervöser. Denn das Zeitgeschenk wurde nicht konsumiert, sondern investiert. So wurden wir immer reicher an Dingen und immer ärmer an Zeit. Das «Rad des Lebens» dreht sich immer schneller. Und der Zeitpfeil der Ökonomie richtet sich ins Unendliche. Das war einmal anders gewesen; jedenfalls anders gedacht. Nicht unendliches Wachstum war für die Klassiker der Ökonomie im 19. und 20. Jahrhundert der Zweck des Wirtschaftens, sondern, wären die Grundbedürfnisse(!) erst einmal gestillt, dann wärs erreicht, das Ende des Wachstums.
Diese Vision stammt aus der Zeit vor dem Aufkommen der Finanzimperien und multinationalen Konzerne. 1930, auf dem Höhepunkt der ersten globalen Wirtschaftskrise, schrieb John Maynard Keynes: «Es mag in der Lebenszeit unserer Enkel ein Punkt erreicht werden, an dem die Grundbedürfnisse in dem Sinne befriedigt sind, dass wir es vorziehen, unsere Kräfte künftig auf nichtökonomische Zwecke zu verwenden.» Will in etwa sagen: Wenn alle Haushalte erst einmal mit den üblichen Gebrauchsgütern ausgestattet wären, dass das Wachstum ohnehin schrumpfen müsste. Das kam auch so – und etwa um diese Zeit begann die chronische Arbeitslosigkeit, nur niemand dachte an Arbeitszeitverkürzung. Noch immer wuchs das Reich der möglichen Dinge. Die Bedürfnisse schienen unendlich – und viele Ökonomen glauben das bis heute.
Die Globalisierung beschleunigte die erlahmende Wachstumsdynamik noch einmal kräftig; der Markt für all die schönen Dinge vervielfachte sich – und das beschleunigt den Weltverzehr (Welt-Verzehr – nehmen Sie das mal bildlich-wörtlich!).
Seit den ersten Studien des Clubs of Rome (Hey, bin ich erschrocken, als ich als Jungsporn zum ersten Mal darin gelesen habe!), seit ein bisschen mehr als einem halben Jahrhundert also, wissen (!) wir um die materiellen und ökologischen Grenzen des Wachstums. Der kommende Rohstoffmangel, der horrende Verbrauch an Süsswasser; das absehbare Ende der Ölförderung – das alles «hat seine Zeit» – seine Jahreszahlen. Es beunruhigt die Beunruhigbaren, dringt wie die Klimakrise in die mediale Öffentlichkeit – und verschwindet dann wieder aus dem Bewusstsein. Warum? Weil bis auf die professionellen Wachstumspriester niemand mehr so richtig daran glaubt, dass wir diese Krise bewältigen werden. Also: verdrängen! Und weil das Ausmass der kommenden Katastrophen (griechisch «die schlechte Wendung») die Fantasie der wissenschaftlichen Warner übersteigt. Die werden ohnehin – so wusste es schon der Prediger Salomon – nicht gehört. Da war eine kleine Stadt in grosser Gefahr, schreibt er, wohl 3000 Jahre vor heute: «Und es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der hätte die Stadt retten können durch seine Weisheit; aber kein Mensch dachte an diesen armen Mann, und auf seine Worte hört man nicht.» Dafür ist auch beim Warnen alles grösser geworden. Die Kollapsliteratur ist ins Unmessbare gewachsen – mit zahlenbewehrten Prognosen und alten Lebenshilfesätzen wie dem, dass Sein kostbarer ist als Haben. Aber wir leben eben nicht mehr in einer kleinen Stadt, sondern in einem Weltsystem. Und auch das hat seine Zeit, und ihr Mass gibt den Takt an für jegliches Geschehen. Es ist die Zeit der globalisierten Produktion, die keinen Ort mehr hat, sondern nur die billigsten Arbeitsbedingungen und Transportwege sucht. Es ist der Zehntelsekundentakt der Finanzmassen, die den Erdball umkreisen auf der Suche nach dem schnellsten und höchsten Profit. Zins, so wollte es die Kirche einmal, sei Sünde, weil Zins eine Steuer auf die Zeit sei. Die Zeit aber gehöre Gott allein. Das ist lange her. Aber selbst nach den Rechnungen der Ökonomen ist das kapitalgetriebene Wachstum längst unwirtschaftlich geworden – denn es ruiniert die Grundlagen des kommenden Lebens auf Erden und macht künftigen Gewinn zunichte.
Die Schöpfung ist am Boden, geht den Gully runter.
Nun, die Einsicht in die Katastrophendynamik mag zu einer individuellen Wende führen, der Ausstieg mag den Einzelnen mit seiner Seele versöhnen, damit geht er aber bloss von der Rennbahn, das wird den Gang des Ganzen nicht bremsen, der Konsumverzicht aufgeklärter Mittelschichten wird alleine nichts wenden, solange Milliarden von Menschen noch arm sind und sich am Lebensstil der Konsumsteigerung orientieren. Das «unendliche Wachstum» auf die Endlichkeit der Welt zurückzuschneiden, das erforderte ein Bewusstsein, ein Bewusstwerden, das sich an langen Fristen orientiert, vor allem aber eine globale, zumindest nationale Politik der Beschränkung und Verlangsamung dessen, was die Materie und Menschen in Bewegung hält und erschöpft.
Moralisieren nützt nichts. Die Frage ist, wie wir «normalen Alltagsmenschen», wie wir unsere Zeit und unser Zeitmass bestimmen. An lauen Sommerurlaubsabenden halten wir uns zugute, dass wir eigentlich doch ganz anders sind und denken. «Wir kommen nur nicht dazu …» und damit schieben wir es auf das System, das uns zwingt, immer zu wollen, was wir nicht wollen. Offenbar ist selbst der durchschaute Systemzwang noch ein Zwang. Wollen ist Müssen geworden.
Leben, das war jenem Weisen nur ein Leben, in dem ein Jegliches seine Zeit findet. Das Pflanzen, das Bauen, das Heilen, das Weinen und das Lachen, das Tanzen und das Herzen, das Suchen und das Behalten, das Schweigen und das Reden, das Lieben und das Hassen, der Frieden – und der Streit. Und den können wir wohl kaum vermeiden, wenn wir einem Jeglichen seine Zeit geben wollen.
Vor Jahren, zu meiner persönlichen «Sturm- und Drangzeit», hat der amerikanische Volkssänger und Aktivist Pete Seeger die Verse Salomons vertont, nur drei Worte hinzugefügt. Die Gruppe «Byrds» hat das Lied in den Sechzigern zum Welthit gemacht: (engl.) «turn, turn, turn!» Das heisst und meint wohl: «Cher-um, cher-di-um!» Wende dich … zurück … zu mir, spricht der Herr.
Eine Rück-wendung, aber das wäre: eine Re-volution.
Krise – Chance
Nationalfeiertag – Ansprache oder Anrufung? 2 Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe … 3a Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken. Psalm 46
Letztes wollen wir ja nicht. Gutes «Klima» schaffen, Frieden gewinnen und bewahren und Land und Leute und Leben schützen, das ja. Doch oft: Laute, eigenrühmende, absetzende Worte, oft Hetzworte, in den Ansprachen grad zu unserem nationalen Feiertag, weit weg vom ersten Teil des Psalmwortes.
Im Grunde wissen wir, dass daraus kein Friede entsteht. Eigenprahlerei lässt die Seele leer zurück: «im Elend». Besinnen wir uns doch (auf Sinn ausrichten).
Es kommt darauf an, wo man hinschaut. Blicken wir nur auf die «Gefahren»? Dann wird die Angst uns bestimmen. Oder blicken wir auf den, der die Hand nach uns ausstreckt, wenn wir rufen «Hilf uns!»? So wird Er unsere «Zuversicht». Zuversicht – das heisst auch: eine neue Sicht – für die Dinge. Für den Grund, die Ursache des bedrohlichen Handelns der «andern» und damit den Grund unserer Angst.
Wir fürchten uns nicht.
Wovor sollen wir uns fürchten, wenn wir in seiner Hand sind? Höchstens davor, dass wir die Not der wirklich Zukurzgekommenen oder -gehaltenen, der Unterdrückten im Land und in der Welt nicht erkennen und uns nicht für das Recht aller einsetzen. Ja, davor.
5 Zünd in uns dein Feuer an, dass die Herzen gläubig brennen und, befreit von Angst und Wahn, wir als Menschen uns erkennen, die sich über Meer und Land reichen fest die Friedenshand.
Quelle «Reformiertes Gesangbuch», Nr. 518 – «Grosser Gott, wir loben dich.»
DICH!
PFARRER KLAUS STOLLER