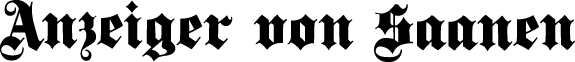Die Geschichte von Juancho
24.10.2017 KolumnenSTEFAN GURTNER
«Weisst du, Stefan, eigentlich mag ich gar nicht mehr leben», sagte Juancho zu mir. Wir waren mit der ganzen Gruppe von «Tres Soles» auf einer Wanderung. Juancho und ich waren etwas zurückgeblieben, weil der damals 13-jährige Junge geschwächt war und nicht so schnell gehen konnte. Er war nur Haut und Knochen, denn vor ein paar Monaten hatte er eine schwere Typhuserkrankung überstanden. Seine Tante, mit der er gelebt hatte, hatte ihn ins Krankenhaus gebracht und ihn dort verlassen. In Bolivien haben nur sehr wenige Menschen eine Versicherung und viele sterben, weil sie die Behandlung und die Medikamente nicht bezahlen können. Eine Nonne, die Patienten zu besuchen pflegte, wurde auf ihn aufmerksam, brachte das nötige Geld zusammen und bezahlte die Rechnungen. Juancho führte sie zum Haus, wo er mit seiner Tante gewohnt hatte – aber sie war mittlerweile ausgezogen, ohne auch nur eine Nachricht zu hinterlassen. Jetzt stand Juancho mutterseelenallein auf der Welt, denn die einzigen Familienmitglieder, an die er sich erinnern konnte, lebten irgendwo weit weg in einem gottverlassenen Tal in den Anden, im Norden von Potosi. «Wie soll man leben wollen, wenn man sich so elend fühlt und einen die eigene Tante im Stich lässt?», fragte Juancho. Ich schaute auf den Boden, nicht so sehr, um nicht über einen Stein zu stolpern, sondern um seinem Blick auszuweichen.
«Aber Juancho, schau doch die Berge, den blauen Himmel, ist das nicht alles wunderbar und Grund genug zum Leben?», hätte ich sagen können, oder: «Sei doch froh, dass du einen Ort gefunden hast, wo du bleiben kannst und wo man dich mag.»
Ich wusste jedoch, dass jedes Wort sinnlos war und nur abgedroschen klingen konnte. Für das, was Juancho erlebt hatte, gab es keine Worte und keinen Trost. Es war nicht das erste Mal, dass ich in solche Gespräche verwickelt wurde. Wenn man sich die Geschichten der Jugendlichen von «Tres Soles» anhört, muss man sich nicht verwundern, dass diese oft in lang anhaltende, depressive Stimmungen verfallen und sogar Selbstmordgedanken hegen. Zwei ehemalige Bewohner von «Tres Soles» haben tatsächlich später auch Selbstmord begangen, andere haben sich buchstäblich zu Tode getrunken. Manchmal kann man solchen Jugendlichen nicht mehr helfen und es ist schlicht und einfach zu spät, umso mehr es in Bolivien, wie bereits erwähnt, keine oder nur schlecht ausgebildete Therapeuten gibt.
«Juancho, du weisst doch, dass dich deine Tante nur deshalb im Krankenhaus verlassen hat, weil sie kein Geld hatte, um die Rechnung zu bezahlen», sagte ich, nachdem wir eine Weile stumm nebeneinander hergegangen waren. «Ja, das verstehe ich, aber warum ist sie dann ausgezogen, ohne eine Nachricht zu hinterlassen?», fragte er eher sich selbst als mich. «Vielleicht hatte sie Angst, dass man sie finden und ihr alles, was sie hatte, wegnehmen würde ...» – «Aber sie hatte doch nicht viel.» – «Gerade deshalb, dann hätte man sie vielleicht sogar ins Gefängnis gesteckt, du weisst doch, wie das hier abläuft.» – «Ja, ja, es ist ein Verbrechen, arm zu sein und das Krankenhaus nicht bezahlen zu können!», brauste Juancho jetzt auf. Wir blieben einen Moment stehen und schauten auf die weissen Gipfel im Hintergrund. Ich atmete die kalte, reine Luft. Ja, die Tante hätte sich irgendwie melden müssen, das war tatsächlich unverständlich. Dass ihr vielleicht etwas zugestossen sein könnte, mochte ich erst recht nicht sagen.
«Juancho, hör mir gut zu», antwortete ich dafür so sachlich wie möglich und blickte ihn an. «Ausser Selbstmord zu begehen, hast du zwei Möglichkeiten: Du gehst in die Schule und nimmst an den Aktivitäten von ‹Tres Soles› teil oder du kehrst in dein Dorf in Potosi zurück.»
Juancho schüttelte den Kopf: «Ich war seit Jahren nicht mehr in meinem Dorf. Ich weiss gar nicht mehr, wie meine Verwandten aussehen oder ob sie überhaupt noch dort sind.» Er wusste auch nicht, wie viele Geschwister er hatte, nur dass sie viele waren. Ebenso wenig wusste er, was aus seinem Vater geworden war, denn er konnte sich nur an die Mutter erinnern und dass alle Geschwister, sobald sie etwas älter waren, als eine Art von «Verdingkindern» zu Verwandten und Paten gegeben wurden. Der kleine Hof, den die Mutter bewirtschaftete, brachte einfach nicht genug ein, um alle zu ernähren. Juancho selbst kam als Sechsjähriger zu seinen Grosseltern in ein Minencamp, wo er auf dem Markt mitarbeiten musste. Eine Händlerin beschuldigte ihn einmal, dass er das Benzin, das sie in Kanistern verkaufte, schnüffelte. «Das stimmte gar nicht, das habe ich erst später gemacht», erinnerte sich Juancho und lachte sogar. «Nachher kam ich zu einer Tante nach Cochabamba. Meistens lebte ich jedoch auf der Strasse. Ich verkaufte Zeitungen, bis ich krank wurde.»
Nach dem Gespräch, das wir bei jener Wanderung geführt hatten, begann Juancho, der von allen «Flaco», der «Dünne», genannt wurde, tatsächlich in die Schule zu gehen und an den Aktivitäten der Wohngemeinschaft teilzunehmen. Er machte beim Sport mit, malte in der Kartenwerkstatt, aber vor allem war es unsere Musikgruppe «Inti Huaynas», was auf Deutsch «Sonnenkinder» bedeutet, die es ihm angetan hatte. Besonders das Charango, eine kleine, zwölfsaitige Gitarre, war sein Lieblingsinstrument. Das Charango ist ein typisch bolivianisches Instrument, heimisch in den hohen Andenregionen im Norden von Potosi, woher Juancho kam. Der helle, jubelnde Klang steht im seltsamen Gegensatz zur kargen und düsteren Landschaft des Hochlandes und der immer etwas traurigen und wehmütigen Volksmusik, die dort üblicherweise gespielt wird. Juancho komponierte sogar einige Lieder und trug sie zusammen mit der Gruppe bei besonderen Anlässen in «Tres Soles» vor. Allerdings konnte er sich nicht entschliessen, Musik zu studieren, wohl hätte er das auch nicht geschafft, sondern er machte eine Lehre als Elektriker in einer Lehrwerkstatt. Im Anschluss daran verloren wir ihn einige Zeit aus den Augen. Wir hörten, dass er eine schlimme Krise durchmachte und viel trank; dann, dass er bei verschiedenen Musikgruppen und Bands mitspielte. Kürzlich besuchte er uns. Er war zwar immer noch sehr dünn, eigentlich hat er sich nie hundertprozentig von jener Krankheit erholt, aber er sah gesund aus und erzählte, dass er eine Frau und ein Kind habe und jetzt als Musiker arbeite.
Stefan Gurtner ist im Saanenland aufgewachsen und lebt seit 1987 in Bolivien in Südamerika, wo er mit Strassenkindern arbeitet. In loser Folge schreibt er im «Anzeiger von Saanen» über das Leben mit den Jugendlichen. Wer mehr über seine Arbeit erfahren oder diese finanziell unterstützen möchte, der kann sich beim Verein «Tres Soles», Walter Köhli, Seeblickstrasse 29, 9037 Speicherschwendi, E-Mail: walterkoehli@ bluewin.ch erkundigen. Spenden: Tres Soles, 1660 Château-d’Oex, Kto.-Nr. 17-16727-4.