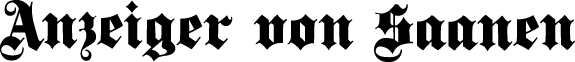Wenn das Dilemma zum Teufelskreis wird
25.01.2019 LeserbeitragSüdosteuropa ist nicht gerade der ruhigste Fleck auf Erden. Durchzugsgebiet seit Jahrtausenden zwischen zwei Kontinenten, ist es einerseits eine wichtige Kulturbrücke, anderseits ein permanenter Unruheherd. Die Expansion des Osmanischen Reiches im 14. Jahrhundert von Kleinasien aus und später der Vorstoss der Habsburgermonarchie von Norden her führten zu dauernder Instabilität. Die beiden Balkankriege von 1912 und 1913 und der Erste Weltkrieg, der ebenfalls im Pulverfass Balkan seinen Anfang nahm, haben die Beziehungen zwischen den Balkanvölkern nachhaltig belastet. Dem Machtzerfall des Osmanischen Reiches und dem Untergang des österreichisch-ungarischen Vielvölkerstaates nach dem Ersten Weltkrieg folgte eine Periode schwieriger Staatenbildung: Nationalistische Maximalforderungen, die fallweise ethnisch, sprachlich-kulturell oder historisch begründet wurden, kamen sich gegenseitig in die Quere. Im Grunde hat sich bis heute an dieser komplexen Gemengelage wenig geändert. Zudem leiden fast alle Balkanstaaten an innenpolitischen Zerwürfnissen, Korruption und demokratiepolitischen Defiziten.
Ein instabiler Balkan ist für Europa nicht einfach ein lästiges Problem im «Hinterhof», sondern ein hohes sicherheitspolitisches Risiko. Deshalb hat die Europäische Union nach den verheerenden Jugoslawienkriegen gegen Ende des 20. Jahrhunderts auch grosse Anstrengungen zur Stabilisierung unternommen, etwa mit der Militärmission Eufor, der Friedenstruppe Kfor und der Rechtsstaatsmission Eulex. Noch 2018 hat Brüssel eine Strategie entwickelt, um Serbien, Montenegro, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Albanien rascher an die EU heranzuführen. Doch die darin enthaltene Absichtserklärung dürfte wohl Makulatur bleiben. Es gibt drei Hauptgründe.
Erstens hat am 1. Januar mit Rumänien turnusgemäss zwar ein Balkanstaat den EU-Ratsvorsitz für ein halbes Jahr übernommen. Doch das Land befindet sich in der tiefsten Krise seit dem Ende des Kommunismus und hat selbst massive Probleme mit den grundlegenden demokratischen Regeln. Als glaubwürdiger Förderer von Rechtsstaatlichkeit fällt Bukarest aus. Zweitens bekunden die Länder des Westbalkans zunehmend Mühe, die EU-Standards in Sachen Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Korruptionsbekämpfung zu erfüllen. Ethnische Konflikte nehmen eher wieder zu, wie die jüngste Verschlechterung der ohnehin äusserst angespannten Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo zeigt. Die EU kann es sich beim besten Willen nicht leisten, Staaten, die nicht in der Lage sind, ihre Unversöhnlichkeit endlich hinter sich zu lassen und in einen konstruktiven Dialog zu treten, eine ernsthafte Beitrittsperspektive zu bieten. Drittens ist die EU ausgerechnet jetzt derart mit dem Brexit und weiteren internen Problemen beschäftigt, dass kaum viel Kapazität übrig bleibt, um sich mit Krisen ausserhalb des eigenen Raums zu beschäftigen. Zudem ist die Lust an erweiterungspolitischen Debatten angesichts der zahlreichen EU-internen Baustellen massiv gesunken.
Die abwartende Haltung der EU in der Balkanfrage ist allerdings fatal. Damit stösst man ausgerechnet jene Staaten vor den Kopf, die im Grunde gerne in den «Brüsseler Klub» aufgenommen werden möchten. Dies wiederum löst Frustrationen aus, welche die angespannte Lage zusätzlich verschärfen könnten, vor allem auch deshalb, weil der Balkan immer mehr in den geopolitischen Fokus von Grossmächten gerät: Russland und China markieren zunehmend Präsenz und kommen damit auch den USA ins Gehege, die in der Region eine Nato-Expansion anstreben. Mit anderen Worten: Die EU müsste dringend Konfliktentschärfung zu ihrem strategischen Ziel erklären. Doch sie steckt in Sachen Balkanpolitik in einem Dilemma, das sich leicht zu einem gefährlichen Teufelskreis entwickeln könnte.
JÜRG MÜLLER