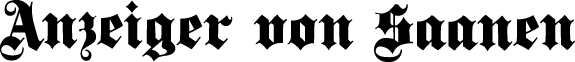Der Gabentisch für Allerseelen an Allerheiligen
07.12.2021 Leserbeitragund warum das so ist …
«So einen Tisch haben meine Tante und mein Onkel auch aufgestellt, als meine Mutter gestorben ist. Sie haben mir gesagt, dass an diesem Tag die Seele meiner Mutter kommt und essen möchte», sagte Liz.
Wir standen nachdenklich vor dem Tisch, den die Kinder von Tres Soles am Morgen des 1. Novembers hergerichtet hatten. Er war mit einem schwarzen Tuch bedeckt und darauf standen verschiedene Schüsseln und Teller mit Süssigkeiten, Gebäck, Brot und Früchten. In der Mitte des Tisches brannte eine Kerze. Daneben lag ein Gebäckstück, geformt wie eine grosse Puppe, und eine Leiter, ebenfalls aus Backwerk hergestellt, lehnte aufgerichtet an einem Glas. Liz war erst vor ein paar Tagen zu Tres Soles gekommen. Sie war ungefähr 15 Jahre alt, hatte eine sehr dunkle Hautfarbe, etwas hervorstehende, aber sehr lebendige Augen und kurzgeschnittene, fast blauschwarz wirkende Haare. Sie trug enge Jeans, die ihr so gar nicht stehen wollten. Ich konnte sie mir gut als eine Cholita in einem typisch bunten Rock und mit dicken Zöpfen vorstellen.
«Als ich zehn wurde, schickten sie mich in einen Haushalt in die Stadt, damit ich Spanisch lerne und mir meinen Lebensunterhalt selbst verdiene. Aber es war kein Haushalt, es war ... so ein Bordell, versteht ihr?»
Guisela, meine Frau, und ich, die neben ihr standen, verstanden nur zu gut. Es war das Schicksal von so vielen jungen Mädchen, die als Cholitas vom Land in die Stadt kamen, ihre Zöpfe abschnitten und ihre Röcke gegen «westliche» Kleidung tauschten.
«Weisst du, was die Sachen auf dem Tisch bedeuten, Liz?», fragte Guisela, nachdem wir eine Weile geschwiegen hatten.
«Ja, die ‹t’anta wawa› stellt den Toten dar, an den man an Allerheiligen denkt.» («T’anta wawa» ist der Name, den man in Bolivien der aus Teig geformten Puppe gibt.)
«Und über die Leiter kommt und geht der Tote, wenn er uns besucht ... Stimmt es, dass die Toten an diesem Tag kommen?»
«Wenn du ganz fest daran glaubst, kommen sie», erwiderte Guisela. Sie stellt zu Hause manchmal auch einen Tisch für ihre verstorbene Mutter auf. Allerheiligen ist mit Sicherheit einer der christlich-katholischen Feiertage in Bolivien, die besonders stark von der Religion der alten Inka und der Aymara beeinflusst worden sind. Schon vor der Zeit der Inka wurden die Toten, teilweise mumifiziert, in Höhlen begraben und Töpfe und Gefässe mit Essen und Trinken für den letzten Gang beigelegt. Die Toten verwandeln sich in «Berggeister», die die zurückgebliebenen Verwandten beschützen, wenn diese einmal pro Jahr das Essen in den Töpfen erneuern. Daraus leitet sich höchstwahrscheinlich die Tradition des «mast’aku», des Gabentisches, wie erauf Quechua heisst, ab, den zu Allerheiligen in Bolivien praktisch alle Familien für ihre Verstorbenen herrichten.
Als weder die Inquisition noch die Dorfpfarrer diesen «heidnischen» Brauch unterbinden konnten, wurde er vermutlich einfach auf Allerheiligen verlegt – so wie man das mit vielen einheimischen Traditionen gemacht hat, um ihnen wenigstens einen christlichen Anstrich zu geben.
«So ein Foto stand auch auf dem Tisch meiner Mutter», meinte Liz und betrachtete die Fotos, die auf unserem Tisch mitten zwischen den Gaben standen. Es waren die Fotos von Bernabé, Eduardo, Germán und Eloy, ehemaligen Mitglieder von Tres Soles. Sie alle waren ums Leben gekommen, bevor ihr Leben auch nur richtig begonnen hatte.
«Meine Mutter war nicht so jung, wie die da auf den Fotos, als sie gestorben ist», sagte Liz leise. Ihre Augen waren feucht, aber sie weinte nicht. Es ist nicht einfach, über die Verstorbenen zu sprechen, die man geliebt hat, und schon gar nicht mit jemandem, den man erst vor ein paar Tagen kennengelernt hat.
«Warum sind die da so jung gestorben?»
«Es waren Jugendliche, die schlimme Probleme hatten», erwiderte Guisela sanft, aber traurig. Auch für sie war es nicht einfach, über die Verstorbenen zu sprechen, denn ihr Scheitern war auch unser Scheitern.
«Bernabé hat sich umgebracht, weil er das Leben nicht mehr ertragen konnte …»
«Wie kann man das?», fragte Liz.
Guisela fand keine Worte, um dem Mädchen, das so viel hatte ertragen müssen, eine vernünftige Antwort zu geben.
«Im Grunde ist es so, als würde man nicht existieren, wenn man keine Familie hat», hatte Bernabé einmal zu mir gesagt. «Niemand denkt an dich, niemand wartet auf dich, niemand spricht zu dir. Gerade so, als ob man tot wäre.»
Sie alle waren auf absurde Weise gestorben. Eduardo, den wir in einer Fensternische im Zentrum von La Paz gefunden hatten, war bei einer Messerstecherei getötet worden. Germán, der wie Liz vom Land stammte, war betrunken von einem Schneesturm überrascht worden und in einer Telefonzelle erfroren und Eloy, den wir buchstäblich aus einer Müllhalde gefischt hatten, als wir Utensilien für eines unserer Theaterstücke suchten, war an einem Herzklappenfehler gestorben, nur weil der Fahrer des Krankenwagens ein Bier trinken gegangen war.
Am 2. November, dem darauffolgenden Tag, in Europa mancherorts als Allerseelentag bekannt, wird der «mast’aku» mit den Lieblingsspeisen der toten Familienmitglieder zum Friedhof gebracht. Gemeinsam wird am Grab gegessen und getrunken. Die Kinder ziehen singend und betend von Grab zu Grab und dürfen sich von jedem Tisch etwas zu essen mitnehmen.
Es sind vor allem notleidende Kinder, die sich die Rucksäcke mit Brötchen und Gebäck füllen und mit nach Hause nehmen. Je reicher die Familie, desto grösser und reichhaltiger ist der «mast’aku» für die Armen, eine «Umverteilung», die die Soziologen an diesen Feiertagen für so besonders wichtig erachten.
Wir gehen allerdings nicht mit den Kindern und Jugendlichen auf den Friedhof. Bernabé, Eduardo und Germán sind in El Alto begraben und das Grab von Eloy auf dem Friedhof von Quillacollo ist vor Kurzem aufgelöst worden, wie es bei öffentlichen Gräbern nach einigen Jahren üblich ist, wenn man nicht teures Geld dafür bezahlen kann.
Wir müssen an die Lebenden denken. Nur noch die Fotos auf dem «mast’aku» erinnern einmal im Jahr, an Allerheiligen, an die Verstorbenen.
STEFAN GURTNER
Stefan Gurtner ist im Saanenland aufgewachsen und lebt seit 1987 in Bolivien in Südamerika, wo er mit Strassenkindern arbeitet. In loser Folge schreibt er im «Anzeiger von Saanen» über das Leben mit den Jugendlichen. Wer mehr über seine Arbeit erfahren oder diese finanziell unterstützen möchte, kann sich beim Verein Tres Soles, Walter Köhli, Seeblickstrasse 29, 9037 Speicherschwendi, E-Mail: walterkoehli@ bluewin.ch erkundigen. Spenden: Tres Soles, 1660 Château-d’Oex, Kto.-Nr. 17-16727-4. www.tres-soles.de