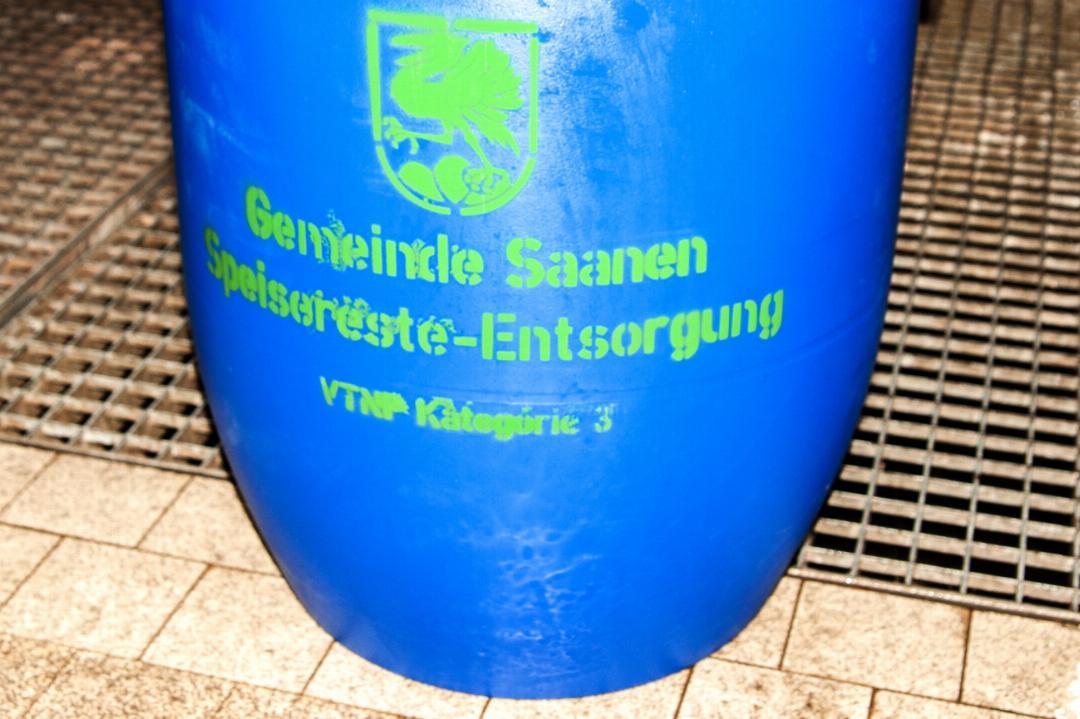Der Kreislauf der blauen Fässer
09.11.2023 SaanenlandHunderttausende von Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle werden schweizweit jährlich in der Gastronomie, im Detailhandel und in Privathaushalten weggeworfen. Im Saanenland kursieren für Speiseresteentsorgung der Gastronomie und Lebensmittelhersteller blaue Fässer. ...
Hunderttausende von Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle werden schweizweit jährlich in der Gastronomie, im Detailhandel und in Privathaushalten weggeworfen. Im Saanenland kursieren für Speiseresteentsorgung der Gastronomie und Lebensmittelhersteller blaue Fässer. Und die haben nur einen einzigen Zweck.
KEREM S. MAURER
«Es isch sehr fein gsy, aber leider chly zviel!» Diesen Satz hören die Servicefachangestellten in unserem Land oft. Zu oft. Denn 14 Prozent – oder 210’000 Tonnen – der rund 2,8 Millionen Tonnen an vermeidbarem Lebensmittelabfall (Foodwaste) fallen laut einer Studie der ETH Zürich von Beretta und Hellweg aus dem Jahr 2019 in der Schweizer Gastronomie an. Aber noch mehr, nämlich 279’000 Tonnen, entstehen im Gross- und Detailhandel und deutlich mehr, sage und schreibe 778’000 Tonnen fallen in den privaten Haushalten an. Pro Jahr.
Nach dem eingangs erwähnten Satz, räumen Servicefachangestellte die Teller ab und bringen die Speisereste zurück in die Küche, wo sie in beschriftete und nur für diesen Zweck zugelassene blaue Fässer geworfen werden. Diese werden regelmässig abgeholt und in die ARA Saanen geführt. Dort werden im Durchschnitt jährlich rund 1000 Tonnen Speisereste verwertet.
Plastik, Knochen und Besteck
An drei Tagen in der Woche rückt Robert Aellen mit seinem blauen Suzuki samt Anhänger aus, um die vollen blauen Fässer in den hiesigen Gastro- und Lebensmittelbetrieben abzuholen und durch leere zu ersetzen. Der Anhänger mit dem Hinweis, dass das Zugfahrzeug mit einer Geschwindigkeit von maximal 45 Stundenkilometern unterwegs ist, darf aus Seuchenschutzgründen einzig für den Transport dieser blauen Speiseresteentsorgungsfässer genutzt werden. «Alle Restaurants, Hotels und Lebensmittelbetriebe können von uns bedient werden», sagt Robert Aellen und erzählt, dass er pro Tour rund zwei Stunden unterwegs ist. «In der Zwischensaison hole ich pro Tour etwa zwanzig Fässer ab. In der Hochsaison können es an Spitzentagen über 60 sein», sagt Aellen. Nachdem er alle blauen Fässer in den Betrieben abgeholt hat, bringt er sie in die ARA Saanen. Dort leert er die Fässer aus und trennt das nicht Verwertbare wie Plastik, Besteck oder Knochen vom Verwertbaren. Danach reinigt er die Fässer mit einem basischen Fettlöser. Zum Schluss stellt Robert Aellen die sauberen Fässer wieder auf seinen Anhänger. Da es für das Einsammeln der Speisereste im Saanenland und Obersimmental insgesamt vier Einsammler gibt, sind die Ablade- und Reinigungszeiten in der ARA genau getaktet und müssen von allen strikte eingehalten werden, erklärt Martin Vonlanthen, Betriebsleiter der ARA Saanen.
Kein Nutztierfutter mehr
Robert Aellens Vorgänger hatte die Speisereste noch den Schweinen verfüttert. Doch seit dem 1. Juli 2011 dürfen keine Küchen- und Speiseabfälle mehr verfüttert werden. Denn Artikel 27 der Verordnung über tierische Nebenprodukte verbietet das Verfüttern von Speiseresten an Nutztieren ausdrücklich. Und was Speisereste sind, wird in Artikel 3 derselben Verordnung unter Buchstabe p definiert (siehe Kasten). Dieses Verbot, das in der EU schon im Jahr 2006 eingeführt wurde, gründet auf der Maul- und Klauenseuche, die kurz nach der Jahrtausendwende in Europa gewütet hatte. In der Folge dieses Gesetzes sahen sich Nutztierhalter gezwungen, Futter für ihre Tiere teilweise aus Übersee einzukaufen. Ist das jetzt besser? «Seuchenschutz ist zwingend nötig. Man muss alles tun, um die Ausbreitung der Schweinepest, die offenbar in Europa auf dem Vormarsch ist, einzudämmen», beantwortet Martin Vonlanthen, der regelmässig mit dem Veterinäramt in Kontakt steht, diese Frage.
Weniger Abfall und Biogas
Die in der ARA abgegebenen Speisereste, Co-Substrate genannt, werden im Faulturm zusammen mit dem Klärschlamm vergoren. «Durch diese Vergärung entsteht Klärgas, das Volumen der Abfälle reduziert sich um einen Drittel», erklärt der Betriebsleiter den Hauptzweck dieser Vergärung. Denn somit muss weniger Abfall in die Kehrichtverbrennung geführt werden. Der ausgefaulte Schlamm wird entwässert, bis er die Konsistenz von feuchter Erde hat, dann wird er nach Thun in die Kehrichtverbrennungsanlage transportiert, wo er thermisch verwertet wird. Und das aus der Vergärung gewonnene Biogas wird in den Blockheizkraftwerken der ARA in elektrischen Strom umgewandelt.
Ein Drittel geht zwischen Acker und Teller verloren
Schaut man sich die Mengen der in der ARA verwerteten Essensreste im Verlauf der letzten Jahre an (siehe Grafik), ist auf den ersten Blick keine abnehmende Tendenz zu erkennen. Doch wenn der Bund seine Ziele umsetzen will, muss in den nächsten sieben Jahre diesbezüglich etwas geschehen. Denn: Im Jahr 2015 verabschiedete die Schweiz zusammen mit 190 anderen Staaten die Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung der UNO. Damit ist die Schweiz gemäss Ziel 12.3 aufgefordert, bis 2030 die Nahrungsmittelverluste pro Kopf auf Detailhandels- und Verbraucherebene zu halbieren und die entlang der Produktions- und Lieferketten entstehenden Nahrungsmittelverluste einschliesslich Ernteverluste zu verringern. Laut der eingangs erwähnten ETH-Studie geht rund ein Drittel der essbaren Anteile von Lebensmitteln zwischen Acker und Teller verloren. Dies seien jährlich 2,8 Tonnen Lebensmittel, die aufgrund des Lebensmittelkonsums in der Schweiz im In- und Ausland anfielen. Auf eine Person hinuntergerechnet entspreche dies rund 330 kg vermeidbarem Lebensmittelverlust pro Person und Jahr.
VERORDNUNG ÜBER TIERISCHE NEBENPRODUKTE
Speisereste: Küchen- und Speiseabfälle, die aus Einrichtungen stammen, in denen Lebensmittel mit tierischen Bestandteilen für den unmittelbaren Verzehr hergestellt werden, wie private Haushalte, Restaurants, Catering-Einrichtungen und Küchen, einschliesslich Gross- und Haushaltsküchen.
DAS HAT DIE NACHFRAGE BEI MIGROS UND COOP ERGEBEN
Geht es um die Angaben von konkreten Zahlen bezüglich des Lebensmittelverlustes in ihren Filialen, geben sich Migros und Coop bedeckt. Während die Coop-Medienstelle «grundsätzlich keine Zahlen ausserhalb des Geschäftsberichts kommuniziert», gibt die Migros – ohne absolute Zahlen zu nennen – an, dass «1,3 Prozent der Lebensmittel in den Migros-Filialen nicht verkauft oder abgegeben werden.»
Was machen Coop und Migros mit Lebensmitteln, deren Verkaufsdaten abgelaufen sind?
Beide versuchen nach eigenen Angaben mit verschiedenen Massnahmen, die Lebensmittelverluste so tief wie möglich zu halten. Beide arbeiten mit «Schweizer Tafel» und «Tischlein deck dich »zusammen. Migros betont, insbesondere in Gstaad mit «Schweizer Tafel» zusammenzuarbeiten, nennt aber keine konkreten Zahlen. Im Gegensatz zu Coop. Coop-Mediensprecher Caspar Frey: «Im letzten Jahr spendete Coop 20 Millionen Teller mit abgelaufenen, aber einwandfreien Lebensmitteln an armutsbetroffene Menschen.» Coop wolle bis Mitte 2026 rund 500 Supermärkte in das Abhol- und Verteilsystem der «Schweizer Tafel» und «Tischlein deck dich» integrieren. «So können zukünftig über 5000 Tonnen Lebensmittel gerettet und rund 25 Millionen Teller armutsbetroffener Menschen gefüllt werden», so Frey. Beide Grossverteiler geben ausserdem an, mit «Too Good To Go» zu arbeiten. Eine für die Migros «sehr sinnvolle und innovative Ergänzung: So kann die Migros auch Lebensmittel vergünstigt weitergeben, für die trotz bestehender Massnahmen keine anderweitige Verwendung mehr möglich ist», sagt Patrick Stöpper, Mediensprecher des Migros Genossenschaftsbundes. Die Coop-Gastronomie habe sich schweizweit «Too Good To Go» angeschlossen, wodurch man im Jahr 2022 rund 123’700 überschüssige Mahlzeiten gerettet habe.
Unter Artikel 104a Ernährungssicherheit der Bundesverfassung schafft der Bund Voraussetzungen für einen ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln. Wie setzen Coop und Migros dies um?
Die Migros orientiere sich an den bundesrätlichen Vorgaben wie etwa dem Aktionsplan Lebensmittelverschwendung und suche Kollaborationen innerhalb der Branche, wie beispielsweise mit der Organisation «United against Waste». Und sie sagt, der wichtigste und zugleich unspektakulärste Faktor in der Bekämpfung von Foodwaste sei eine gute Planung und eine effiziente Logistik, denn: «Auch wirtschaftliche Treiber motivieren uns, unsere Lebensmittelverluste möglichst klein zu halten. Jedes Produkt, das wir eingekauft haben und später vernichten müssen, bringt nichts ein».
Coop verweist auf ihre Säule «Nachhaltige Sortimente», die sich dieser Thematik konkret annehme. Die Ziele in diesem Bereich umfassten unter anderem die Förderung eines reduzierten Ressourcenverbrauchs im Sortiment, die Anwendung verschiedener Nachhaltigkeitsstandards in der Rohstoffbeschaffung, die Förderung des Biolandbaus sowie die Reduktion des Wasserfussabdrucks und den Erhalt der Biodiversität entlang der Lieferketten. Bezüglich Vermeidung von Food Waste werde angestrebt, dass bei Coop der Anteil der Lebensmittel, der für die menschliche Ernährung verwendet wird, bis 2026 auf mindestens 99,5 Prozent erhöht werde.
SIE HELFEN, FOODWASTE ZU VERMEIDEN
«Tischlein deck dich» rettet Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilt sie an armutsbetroffene Menschen in der ganzen Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Jede Woche erreicht die Organisation an ihren 156 Abgabestellen und indirekt über andere Lebensmittelhilfen etwa 31’400 Menschen in Not. Der Verein «Tischlein deck dich» ist eine Initiative aus der Wirtschaft. Getragen von Vernunft, Professionalität und Engagement (ISO 9001 zertifiziert).
«Schweizer Tafel» sammelt täglich über 24 Tonnen einwandfreie, überschüssige Lebensmittel im Detailhandel ein und verteilt sie kostenlos an 500 soziale Institutionen wie Obdachlosenheime, Gassenküchen, Notunterkünfte oder Frauenhäuser und andere Hilfswerke: jährlich über 6100 Tonnen im Wert von 42,6 Millionen Franken. Das entspricht 17,5 Millionen Mahlzeiten im Jahr.
«Too Good To Go» ist eine mobile App, die Kunden mit Restaurants und Geschäften verbindet, die unverkaufte, überschüssige Lebensmittel haben und diese zu einem vergünstigten Preis an Selbstabholer verkaufen. Die Kunden bestellen und bezahlen direkt über die App und brauchen ihre Portion dann nur noch im angegebenen Zeitfenster im Laden abzuholen.