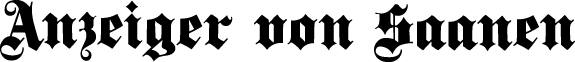Nicht besser, aber anders
16.08.2019 Gstaad250 Jahre Erfahrung bringen die sechs Bergführer Werner Imdorf, Adolf Hauswirth, Ruedi Widmer, Ueli Grundisch, Arnold Hauswirth und Bernhard Raaaflaub mit. Beim Gespräch im Posthotel Rössli erzählten sie Episoden aus drei Generationen Bergführerausbildung, die unterschiedlicher nicht sein könnte.
BLANCA BURRI
Seniorpatron Ruedi Widmer ist selbst Bergführer, somit ist das Posthotel Rössli für ein Gespräch unter Berufskollegen prädestiniert. Gemütlich sitzen sechs Bergführer unterschiedlicher Generationen um den Holztisch, ein paar rote Führerbücher liegen auf der Tischplatte, ein legendärer Rubi-Rucksack hängt an einer Stabelle. Während Werner Imdorf (Lenk), Adolf Hauswirth (Gstaad), Ueli Grundisch (Gstaad), Arnold Hauswirth (Saanen) und Bernhard Raaflaub (Turbach) sich austauschen, holt Ruedi Widmer kurzerhand ein paar Ski und Berg- beziehungsweise Skischuhe von anno dazumal aus dem Keller. Das Bergfeeling ist komplett – nein, eigentlich nur fast, denn es fehlt der legendäre Bhend-Pickel.
Die Ausrüstung war schwer und sperrig
Ja, die Ausrüstung war früher definitiv eine andere als heute. Selbst Anfänger sind momentan mit leichter Funktionswäsche, ultraleichten Ski und Skischuhen sowie federleichten Rucksäcken und Pickeln unterwegs, denn jedes Gramm, das man den Berg hochschleppt, zählt. Ruedi Widmer aber bringt lange, schmale Holzski und harte, lederne Bergschuhe aus dem Keller. Alles ist sperrig und schwer. Damit haben Bergführer wie Gäste früher dieselben Bergtouren absolviert wie die Jungen mit modernen Materialien heute. Vor allem das Skifahren mit den gebundenen Lederschuhen und den langen, schmalen Ski hat vielen Mühe bereitet. «Nur wirklich gute Skifahrer kamen mit dem einfachen Material zurecht», erinnert sich Ruedi Widmer. «An der Skiprüfung hat mir der Lehrer vorgehalten, ich habe zu viel Rücklage, daran erinnere ich mich noch genau.»
Kletterfinken oder Bergschuhe?
Obwohl es seit geraumer Zeit Kletterfinken gibt, waren sie während der Bergführerausbildung noch lange verboten. «Für alle Touren, egal wie schwierig, mussten wir die schweren Bergschuhe tragen», sagt Imdorf, der seine Bergführerausbildung 1958 abschloss. Er erinnert sich aber auch an Schumacher Balmer, der bereits in den 1960er-Jahren zwei Arten Lederschuhe produzierte. Harte und breite für Bergtouren sowie etwas weichere, schmalere mit einem kürzeren Vorbau für Kletterabenteuer. Bernhard Raaflaub ist der Jüngste am Tisch und erzählt, wie es mit den Kletterfinken heutezutage steht: «Bei einem Teil der Kletterprüfung sind Finken Pflicht, beim anderen Bergschuhe.»
Ohne Bhend-Pickel geht nichts
Auch anderes hatte früher einen grösseren Stellenwert. Wer in der Bergsteigerszene ein gewisses Ansehen haben wollte, brauchte bis in die 2000er-Jahre zwei Gegenstände: einen Rubi-Rucksack und einen Bhend-Pickel. Werner Imdorf zeigt seinen Rubi-Rucksack, der sich mit wenigen Handgriffen in verschiedene Füllgrössen verstellen lässt. «Ich liebe diesen Rucksack. Er liegt perfekt und die Träger fallen nie über die Schultern», schwärmt er. Die Bhend-Pickel waren massgeschneidert. Die Länge des Schafts und dessen Neigung wurden auf den Käufer zugeschnitten. Doch wer konnte sich in seiner Jugend schon ein solches Gerät leisten? Auch die Lieferfristen waren, je nach Herkunft des Käufers, bedenklich lange. Als Alternative nahm Ueli Grundisch einen Charlet-Moser-Pickel, ein schönes Stück, mit in die Bergführerausbildung. «Ich wurde schier ausgelacht», meinte er trocken. Trotzdem hat er die Prüfung gut bestanden, sogar ohne Rubi-Rucksack. Wie sich beim Gespräch herausstellt, ist der Pickel sowieso ein Buch mit sieben Siegeln. Es kommt auf verschiedene Faktoren an, ob er zum Träger passt. «Je nach Biegung gibt es beim Benutzen einen Rückschlag, das ist unangenehm», weiss Werner Imdorf.
Die Touren sind nicht mehr dieselben
Wenn Werner Imdorf vom «z Bärg» gehen erzählt, leuchten seine Augen. 18-stüngige Mammuttouren gehörten regelmässig in sein Programm. Wenn er die Gipfel aufzählt, die er mit Bergkameraden bei den Tages- oder Zweitagesmärschen bestiegen hat, staunt man nicht schlecht. Ueli Grundisch relativiert, ohne die Leistung der Bergsteiger der 1970er-Jahre zu schmälern: «Früher, als die drastische Gletscherschmelze, ausgelöst durch die Klimaerwärmung, noch nicht eingesetzt hatte, gab es hohe Eisschichten, über die man wandern konnte. Das vereinfachte die Touren massiv.» Die Gletscher konnten fast als Wanderwege benutzt werden, so musste man nicht gleich tief ins Tal absteigen wie heute, das verkürzte die Strecke und die Höhenmeter. Heute beschäftigt auch das Phänomen Steinschlag. «Wir werden deshalb regelmässig in Sachen Steinschlag ausgebildet», sagt Bernhard Raaflaub. «Die Ausbildner raten uns, im gefährdeten Gebiet Abstand zwischen den Berggängern einzuhalten, um das Risiko zu vermindern, dass jemand von herunterfallenden Steinen oder Felsbrocken getroffen wird.»
Unterschiedliche Erfahrungen
Das Herz schlägt bei allen Versammelten für die Bergluft, für ein Leben zwischen Fels und Eis. Und doch ist ihre Motivation für die Bergführerausbildung ganz unterschiedlich. Während Werner Imdorf, Arnold Hauswirth, Ueli Grundisch und Bernhard Raaflaub sich dem Bergführerwesen verschrieben, blieb es für Ruedi Widmer und Adolf Hauswirth ein Hobby. Adolf Hauswirth war zudem an den Landwirtschaftsbetrieb gebunden. «Manchmal hatte ich Gäste, die ich von der Wildhornhütte auf den gleichnamigen Gipfel führte. Hie und da musste ich am Abend von der Hütte in den Betrieb in Saanen absteigen, um die Tiere zu füttern.» Am kommenden Morgen stieg er nach den Stallarbeiten wieder in die Hütte auf, um mit den nächsten Gästen den Dreitausender zu besteigen. «Ich habe die Ausbildung wohl gemacht, aber den Beruf nie vollamtlich ausgeführt», resümiert er. Den Bergführern ist bewusst, dass sie damit ganz andere Voraussetzungen mit ins Bergmetier brachten als zum Beispiel der 85-jährige Imdorf. Der Weg zur Ausbildung beschreibt der Lenker so: «Ich liess mich in der Bergsteigerschule Meiringen als Träger anstellen und war so in den Sommermonaten täglich im Gelände unterwegs.» Als Träger bezeichnete man früher die heutigen Aspiranten.
Für Ruedi Widmer war es wie für Adolf Hauswirth nicht so einfach, sich voll und ganz auf die Berge zu konzentrieren, denn er war hauptberuflich Hotelier. In der Trägerzeit ging er so oft es seine Arbeit zuliess mit Freunden und Bekannten ins Gebirge.
Der während der Ausbilung topfite Imdorf lächelt beim Gedanken, mit wie viel Mühe ein paar seiner Kollegen die dreiwöchige Ausbildung absolviert hatten. «Es ging nicht allen gleich einfach. Shorty zum Beispiel haben wir gezogen und gestossen, damit er ans Ziel kam.» Ihm ist aber auch bewusst, dass nicht alle das Privileg hatten, sich bereits in der Bergsteigerschule so viel Erfahrung und Fitness anzueignen wie er.
Herkunft war wichtig
Regionale Unterschiede waren in den Anfängen der Bergführerausbildung ein grosses Thema. Je nachdem, woher ein Aspirant stammte, wurde er verwöhnt oder geschnitten. Die Einheimischen wurden laut den Aussagen der drei Senioren sowie dem Buch «Gipfelwärts: Ein junger Bergführer erzählt», von Paul Etter, bevorzugt. Zitat aus dem Buch: «In der Konkordiahütte aber, wo wir unter Oskar Ogis wertvoller Leitung Eisausbildung geniessen, haben wir, die nicht einheimischen Aspiranten, für eine Dose Bier ganze fünfzig Rappen mehr zu bezahlen.»
Bergsteigerschulen: nicht im Saanenland
Die Bergsteigerschulen sind hauptsächlich im Wallis, Graubünden und östlichen Berner Oberland sehr bekannt. Kunden können dort Ausbildungsgänge und geführte Touren buchen. Im Saanenland hat sich aber nie eine Schule durchgesetzt. «Das Gebiet ist zu lieblich und für Klettertouren zu wenig prädestiniert», weiss Ueli Grundisch. Deshalb habe sich eine Schule nie aufgedrängt. Das ist in Zermatt anders, das von mehr als zehn Viertausendern umgeben ist. Und doch gibt es im Saanenland viele Möglichkeiten, auch dank Partnern: «Über das Alpinzentrum haben wir Bergführer die Möglichkeit, in unserer Region zu arbeiten.»
Eine Familie
Wie überall ist die Welt der Bergführer auch im Saanenland eine kleine. Wie in einer Familie unterstützt man sich gegenseitig, hilft, wo es nötig ist und tauscht sich aus. Es gibt auch eine Online-Plattform mit dem Namen Bergsport Gstaad. Sie vereint die Kompetenzen von vier Bergführern. Trotzdem verdienen sich Aspiranten und junge Bergführer vor allem in den Schweizer Bergsteigerschulen und beim Begleiten ihrer älteren Berufskollegen ihre Sporen ab. Bei den gemeinsamen Touren knüpfen sie Bezieungen zu den Gästen, die auf gegenseitigem Vertrauen basieren und in eine langjährige Bergbeziehung münden können.
Härtere Ausbildung
Wenn man die Veränderung der Ausbildung zum Bergführer von den 1960er-Jahren bis heute betrachtet (siehe Kasten), wird schnell klar: Die Ausbildung ist anspruchsvoller, länger und teurer geworden. Als Grund nennt Ruedi Widmer die folgenden Gründe: «Früher gingen wir einfach ‹z Bärg›. Heute gibt es viele einzelne Disziplinen, die ausgebildet und praktiziert werden.» Natürlich habe man sich früher manchmal auch neben den direkten Routen auf die Gipfel fortbewegt, aber weniger intensiv als heute. Arnold Hauswirth: «Früher waren die Gäste gipfelorientiert, heute sind die Berge zu einem Spielplatz geworden: Sportklettern, Eisklettern, Canyoning und vieles mehr ist zum Trend geworden.»
Respekt vor den Bergkollegen
Falls er alle Prüfungen besteht, geht für Bernhard Raaflaub im kommenden Herbst ein grosser Traum in Erfüllung. Er ist ambitionierter Skifahrer und möchte im Winter und Sommer vom neu erlernten Beruf leben, aber zwischendurch weiterhin in der Holzbranche tätig bleiben. Im Gespräch wird deutlich, wie viel Respekt die älteren Bergführer dem 27-Jährigen zollen, welcher kurz vor Ausbildungsende zu seinem Bergführerbrevet ist. Der bescheidene Turbacher wehrt ab: «Ich respektiere die grossartige Arbeit der älteren Bergführer. Ich finde nicht, dass wir jetzt eine grössere Leistung erbringen.» Im Gegenteil, er schaut zu seinen Vorbildern auf. «Die Erstbegehungen von früher sind mit solchen von heute nicht zu vergleichen. Es waren richtige Abenteuer. Man hatte wenig Informationen über den Berg, über das Wetter und die Schneelage. Dazu kommt die einfache Ausrüstung.» Nur schon die Anreise in ein abgelegenes Gebiet habe Wochen gedauert. Die heutigen Transportmittel, GPS, Handy, die Infos aus dem Internet und im Austausch mit Bergkollegen vereinfachten vieles, meint er. «Man weiss in etwa, was auf einen zukommt.» In diesem Zusammenhang erinnert sich Werner Imdorf an eine Erstbegehung. Erst beobachteten er und sein Bergkollege eine Seilschaft, welche den Aufstieg auf den Kastor, Engelhörner, abbrachen. Als diese auf Anfrage bekundeten, dass sie die Erstbesteigung kein zweites Mal in Angriff nehmen würden, bereiteten sich Werner Imdorf und sein Kollege vor: Aus Birkenholz stellten sie Keile mit Loch her, in das eine Reepschnur mit Karabiner passte. Sie benutzten sie zum Erklimmen eines Kamins, das mehrere Seillängen lang war. In 14 Stunden durchstiegen sie die glatte Karstwand.
Respekt vor dem Berg?
Das Gespräch wird von den Servicemitarbeitern des Posthotels Rössli unterbrochen. Sie bringen ein Plättli mit frischem Brot und Butter. Ein Gläschen Wein rundet den Imbiss ab. Dadruch nimmt die Gesprächsrunde eine neue Wendung. Der Senior der Bergfüher möchte von seinen jüngeren Berufskollegen wissen, wie es heutzutage um den Respekt vor dem Berg stehe. «Der Respekt ist geblieben», bekundet Arnold Hauswirth. Bernhard Raaflaub ist anderer Meinung: «Ich glaube, dass diese Aussage fürs Freeriden nicht zutrifft. Das gute Material und die unbefahreren Hänge verleiten dazu, dass die Skisportler mehr Risiken eingehen.» Ueli Grundisch ergänzt: «Es gibt vermehrt Unfälle von gut ausgerüsteten Schneesportlern. In diesem Winter kamen zwei Menschen ums Leben, obwohl sie einen Airbag trugen.» Er begründet: «In einer Lawine geht alles einfach zu schnell, deshalb konnten sie den Airbag wohl nicht mehr auslösen.» Er ist sich aber sicher: «Leute, die im Gebirge zu Hause sind, haben den Respekt vor dem grossen Berg, dem Eis und dem Gletscher behalten. Unterländer verfügen nicht über denselben Instinkt.» Wegen lukrativen Sponsorenverträgen und spannenden Online-Auftritten gehen Extremsportler grosse Risiken ein. Aus der Sicht der Bergführer sollten diese viel besser eine Vorbildfunktion wahrnehmen, denn: Wenn junge, wenig trainierte Menschen ihren Pfaden folgten, gibt das böse Unfälle, sind sich die Bergführer einig. Nur die qualitativ hochstehende Bergrettung könne viel Schaden verhindern.
Wie steht es mit dem Nachwuchs?
Weil es zu wenig einheimischen Nachwuchs gibt, arbeiten zurzeit viele Deutsche und Österreicher in Schweizer Bergsteigerschulen, weiss Arnold Hauswirth. Als Grund dafür nennt Bernhard Raaflaub: «Die Ausbildung ist sehr intensiv, sodass nur etwa 50 Prozent der Absolventen, welche die Ausbildung beginnen, es überhaupt ins Aspirantenjahr schaffen. Die Ausbildung abzuspecken komme aber nicht infrage. «Das Ausbildungsprofil ist international geregelt, alle haben dieselben Prüfungen.» Im Verlauf des Austauschs zeigt sich aber, dass es sehr wohl regionale Unterschiede gibt. «In der Schweiz legt man viel Wert aufs Skifahren, im Südtirol dafür aufs Klettern», meint der Jüngste am Tisch. Auch die mittlere Generation, Arnold Hauswirth und Ueli Grundisch, erinnert sich, dass es Unterschiede während ihrer Ausbildungszeit gab. Damals belegten die guten Skifahrer den Berner und die guten Kletterer den Walliser Kurs.»
Wenig Sicherheit
Im Saanenland sind die Bergführer vor allem im Winter sehr gefragt. Die lieblichen Voralpen laden täglich zu schönen Skitouren ein, und weil es viele ungefährliche Routen gibt, bieten sich auch bei schwierigen Wetter- oder Schneeverhältnissen Alternativen an. Deshalb gibt es im Winterhalbjahr in der Region genug Arbeit. Im Sommer aber ziehen viele Bergführer aus, um ihr Brot in der Nachbarschaft oder im Ausland zu verdienen. «Wollen wir bei unseren Familien bleiben, müssen wir Bergführer uns im Sommer mit einem Zweitberuf ein Zubrot verdienen», sagt Arnold Hauswirth.
Das Gespräch ist auch nach zwei Stunden angeregt, respektvoll und spannend. Zwischen die ernsthaften Themen schleichen sich lustige Episoden ein. Manchmal wird sogar ein wenig «plagiert». Obwohl die Journalistin gerne weitere Berggeschichten gehört hätte, ist es nach dem Fototermin für sie Zeit, zu gehen. Die Bergfreunde bleiben zurück und geniessen das Beisammensein noch ein wenig, bevor sie sich wieder in alle Winde verstreuen.
Buchtipp: «Gipfelwärts: Ein junger Bergführer erzählt», 1968, von Paul Etter
VERRÜCKTE TOUREN
An zwei Touren erinnert sich der Lenker Bergführer Imdorf besonders gut: «Wir waren zu viert unterwegs, alles Bergführer. Die Tour ging zur Kingwand (2621 m ü. M.). Nach dem Aufstieg beschlossen wir, am gleichen Tag das kleine Wellhorn (2625 m ü. M.) anzuhängen. Nach reiflicher Überlegung nahmen wir aus Gründen der Vorbildfunktion eines Bergführers den längeren, aber sicherern Weg unter die Füsse und standen um 17.30 Uhr auf dem zweiten Gipfel. Wir fühlten uns gut und genossen die beiden Bergspitzen. Dumm war nur, dass am nächsten Tag das Sustenrennen anstand. Das war dann zu viel, ich brachte keine nennenswerte Leistung mehr.»
«In meinen jungen Jahren», erzählt Imdor, «war es gang und gäbe, die Gäste in einer Fünfer-Seilschaft aufs Matterhorn zu bringen.» «Das ginge heute nicht mehr», sagt Ueli Grundisch spontan, «Die Sicherheitsaspekte werden viel höher gewichtet, deshalb sind höchstens Dreier-Seilschaften geduldet.» «Ich weiss, aber früher war das einfach so», entgegnet ihm der Lenker, «meine Gäste waren immer sehr gute Bergsteiger, deshalb ging es so.»