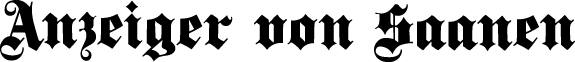«Manchmal schäme ich mich dafür, Schweizerin zu sein!»
23.04.2021 InterviewNicole Maron wohnt in Peru und setzt sich für die Umwelt und für mehr Gerechtigkeit ein. Sie prangert den global ausgerichteten, westlich-zivilisierten Lebensstil als ausbeuterischen Neokolonialismus an, schrieb einen offenen Brief an Aussenminister Ignazio Cassis und zeigt mit dem Finger auf Punkte, die weh tun.
KEREM S. MAURER
Nicole Maron, Sie bezeichnen den global orientierten westlich-zivilisierten Lebensstil als ausbeuterischen Neokolonialismus. Was genau ist darunter zu verstehen?
In Lateinamerika und anderen Regionen des Globalen Südens sind die Auswirkungen der Globalisierung sehr deutlich spürbar. Die weltweiten Wirtschaftsbeziehungen beruhen immer noch auf Ausbeutung, obschon das Zeitalter des Kolonialismus angeblich vorbei ist. Heute erleben wir eine extreme Form des Neokolonialismus, die nicht durch Waffengewalt, sondern durch wirtschaftliche und politische Druckmittel aufrechterhalten wird. Die Bevölkerung in Ländern wie Peru oder Bolivien trägt die Konsequenzen dieses Modells, welches den luxuriösen und gut abgesicherten Lebensstil in Ländern wie der Schweiz ermöglicht.
Welche Konsequenzen denn?
Beispielsweise die Abholzung von Regenwäldern oder der Bergbau. Weltweit wird pro Minute eine Regenwaldfläche in der Grösse von 30 Fussballfeldern gerodet, ein Zehntel allein in Brasilien. Ein grosser Teil davon wird für die Produktion von Soja verwendet, sprich für Futtermittel für Vieh, dessen Fleisch nach China, in die USA und nach Europa exportiert wird. Bergbauaktivitäten vergiften Wasser, Böden und die Luft, womit die Lebensgrundlage der indigenen Bevölkerung vor Ort zerstört wird.
Kennen Sie Fälle von solchen Vergiftungen?
Auf jeden Fall. Wir sprechen von Menschen, die 17 verschiedene Schwermetalle im Blut haben und deren Tiere sterben, weil sie Wasser aus vergifteten Flüssen trinken.
Können Sie Schweizer Firmen benennen, die nachweislich mitschuldig an dieser Misere sind?
Ja. In Espinar, auf halber Strecke zwischen Puno – wo ich lebe – und Cusco, betreibt die Schweizer Firma Glencore drei Bergwerke, die seit fast 40 Jahren gravierende Schäden an der Umwelt und an der Gesundheit der Menschen anrichten. Der Konzern geht dabei mit einer unvorstellbaren Gleichgültigkeit und Arroganz vor. Es geht nur um den Gewinn. Aber natürlich sind in Peru diverse transnationale Bergbauunternehmen tätig.
Wie verhält sich die peruanische Regierung?
Die peruanische und auch die Schweizer Regierung stellen sich auf die Seite der Konzerne, weil der Staat durch Steuereinnahmen von diesen Geschäften profitiert. Im letzten November hat der Schweizer Bundesrat empfohlen, die Konzernveranwortungsinitiative abzulehnen, weil er wirtschaftliche Schäden für die Schweiz befürchtete. Damit macht die offizielle Schweiz für mich deutlich: Die Wirtschaft und der eigene Wohlstand haben Priorität vor den Menschenrechten.
War das der Grund dafür, dass Sie am 28. Feburar 2021 einen Brief an Herrn Bundesrat Ignazio Cassis geschrieben haben?
Ich habe den Brief im Rahmen meiner Kolumne in der Zeitschrift «Zeitpunkt» publiziert. Grund für diesen Brief war Cassis’ Bekanntgabe im Dezember, wonach künftig keine DEZA-Gelder (DEZA = Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, Anmerkung der Redaktion) mehr für Informations- und Sensibilisierungsarbeit in der Schweiz eingesetzt werden dürfen.
Heisst im Klartext?
Das bedeutet, dass sich die Entwicklungszusammenarbeit schön brav auf ihre Projekte im Globalen Süden konzentrieren und ja nicht in der Schweiz bekannt machen soll, welche Schäden die Schweizer Politik und Wirtschaft im Ausland anrichten. Es werden Umweltzerstörung, Klimakrise und der Tod von Menschen in Kauf genommen, damit die Schweizer Bevölkerung ihren konsumorientierten Lebensstandard erhalten kann. Denn die Metalle, die hier im Bergbau gefördert werden, landen in Batterien und Elektrogeräten, die wir in der Schweiz zuhauf kaufen.
In diesem Brief wünschen Sie sich einen Bundesrat, der Verantwortung übernimmt und Ethik über die wirtschaftlichen Interessen stellt, damit Sie sich nicht mehr zu schämen brauchen, wenn Sie sagen, Sie seien Schweizerin. Schämen Sie denn sich dafür?
Ja, leider ist das tatsächlich oft der Fall. Denn ob es mir passt oder nicht bin ich Teil des Systems, welches auf globaler Ungerechtigkeit aufbaut. Mit meinem Pass und dem für die hiesigen Verhältnisse hohen Lohn habe ich nicht nur in der Schweiz, sondern auch hier Privilegien, die für die hiesige Bevölkerung nicht selbstverständlich sind. Zum Beispiel der Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung.
Haben Sie von der offiziellen Schweiz eine Reaktion auf diesen Brief erhalten?
Nein, ich bin wohl zu wenig berühmt, um die Aufmerksamkeit des Bundesrates zu erregen.
Wie wird denn in Ländern wie Peru oder Bolivien, die – gemäss der Liste der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) in Zusammenarbeit mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD – als Entwicklungsländer gelten, die Schweiz und ihre Politik wahrgenommen?
Das hängt davon ab, wen man fragt. Mitarbeitende des Staatsapparats oder Unternehmerinnen sehen die Schweiz und andere Länder, die hier vor Ort investieren, sehr positiv, weil sie wirtschaftliches Wachstum generieren. Doch wenn man mit der indigenen Bevölkerung spricht, die direkt unter den politischen Entscheidungen und wirtschaftlichen Aktivitäten der Schweiz leidet, sieht die Sache anders aus.
Ich nehme an, Sie haben dafür ein Beispiel?
Ja. Ich habe im Januar in Espinar für einen Dokumentarfilm über die Glencore-Bergwerke Interviews in indigenen Gemeinden gemacht. Eine ältere Frau hat mich gebeten, einen Aufruf an die Schweiz und an die CEOs von Glencore zu veröffentlichen.
Was genau hat diese Frau gesagt?
Sie sagte: «Ich leide seit meiner Kindheit unter dem Bergbau. Mein Vater hat bis zu seinem Tod in einem Bergwerk gearbeitet, doch meine arme Mutter hat weder eine Versicherung noch eine Rente. Uns wurde Schulbildung versprochen, doch für uns einfache Leute, für uns Indigene, gibt es hier keine Gerechtigkeit. Und wir sind nicht die Einzigen. Sicher leiden auf der ganzen Welt Kinder wie hier. Wie viele Mütter werden wohl wegen des Bergbaus geschlagen, wie viele von ihren Territorien vertrieben? Besitzer des Bergwerks, ich appelliere an euch: Warum müssen wir leiden? Ihr sollt uns verstehen und unterstützen! Ich mache diesen Aufruf aufgrund meines tiefen Leids.»
Sie geben dem Konsumverhalten der Schweizerinnen und Schweizer eine Mitschuld an der geschilderten Misere. Was kann im Alltag getan werden, um diese zu mildern?
Man kann das eigene Konsumverhalten ändern. Braucht man zum Beispiel jedes Jahr ein neues Handy oder jedes neue elektronische Gadget? Sich seines ökologischen Fussabdruckes, der in der Schweiz höher ist als in vielen Entwicklungsländern, bewusst werden. Organisationen wie Public Eye stellen sehr viel Informationen und Tipps für nachhaltigeren Konsum zur Verfügung. Eigentlich kann man heute nicht mehr sagen: Ich habe das nicht gewusst. Womit man aber meiner Meinung nach noch viel mehr erreichen kann, ist mit politischem Engagement. Wir haben in der Schweiz die Möglichkeit, bis zu einem gewissen Punkt Einfluss auf die Entscheidungen zu nehmen. Und dies sollten wir auf jeden Fall ausnützen.
Warum wohnen Sie heute in Peru?
Nachdem ich ein gutes Jahr in Kurdistan gelebt hatte, wollte ich mit Lateinamerika eine andere Region der Welt kennenlernen, wo es starke soziale Widerstandsbewegungen gibt, die sich genau gegen dieses oben geschilderte System der Unterdrückung und Ausbeutung wehren. Im Auftrag von Comundo, einer Organisation in der personellen Entwicklungszusammenarbeit, bin ich zuerst nach Bolivien und dann nach Peru geschickt worden. Ich lerne hier sehr viel, nicht nur politisch und sozial, sondern auch kulturell und spirituell.
Was haben Sie denn gelernt?
In der Andenregion und auch im Amazonasgebiet findet man ganz andere Denkweisen und Lebensrealitäten, welche den «sogenannten Fortschritt» und das wissenschaftlich-akademische Weltbild in Frage stellen. Sogenannter Fortschritt deshalb, weil ein Lebensstil, der die Zerstörung unseres Planeten zur Folge hat, unmöglich fortschrittlich genannt werden kann, sondern eher primitiv und dumm. Schliesslich vernichten wir allmählich unsere eigene Lebensgrundlage. Trotzdem massen sich die selbst ernannten Industriestaaten an, den Menschen in den Entwicklungsländern beizubringen, wie man ein besseres Leben führt.
Das Leben in Industriestaaten ist also nicht besser als in Entwicklungsländern?
Nein, denn die Industriestaaten-Definition von einem besseren Leben beruht vor allem darauf, mehr Geld zu haben. Doch dies dient vor allem der Wirtschaft. Ich kenne viele Menschen, die in der Schweiz im Alter zwischen 30 und 40 Jahren ein Burn-out hatten, weil sie dem Druck der Arbeitswelt, die uns stets zur Optimierung und Effizienz drängt – zwei grauenhafte und ungesunde Wörter – nicht mehr standgehalten haben. Sogar Primarschulkinder leiden in der Schweiz aufgrund des Leistungsdrucks unter Depressionen. Ist ein System, das Menschen krank macht, tatsächlich ein gutes System?
Sie wollen dieses System verändern?
Ich sehe meine Aufgabe darin, die Erfahrungen, die ich hier mache, mit der Leserschaft in der Schweiz und in Deutschland zu teilen, in der Hoffnung, damit etwas dazu beizutragen, dass Menschen mehr darüber nachdenken, was ihre Lebensweise anderswo für Auswirkungen hat. Vielleicht kann so ein bitter nötiger Bewusstseinswandel angeregt werden. Denn das heutige Wirtschaftssystem hat eine Konsumgesellschaft hervorgebracht, die uns schlussendlich alle an den Rand des Abgrunds bringen wird.
Mit Ihrer Ausbildung könnten Sie in der Schweiz oder in anderen sogenannten Erstweltländern gute Jobs für gutes Geld ausüben, wogegen die Verdienstmöglichkeiten in Peru eher geringer ausfallen dürften. Ist das Ihnen egal?
Absolut! Mit einem Einsatz in der personellen Entwicklungszusammenarbeit erkläre ich mich explizit mit einem Minimallohn und einem einfachen Lebensstil einverstanden – wobei diese Definition natürlich auch nur aus Schweizer Sicht Sinn macht. Gemessen an den lokalen Löhnen verdiene ich hier sehr gut und bin obendrein krankenversichert. Doch selbst wenn ich deutlich weniger verdiente, wäre es mir egal! Ich habe meine beruflichen Tätigkeiten noch nie vom Verdienst abhängig gemacht, sondern allein davon, ob ich mit meiner Arbeit etwas bewirken kann, was ich als sinnvoll und wichtig erachte. Solange ich von meinem Lohn leben kann, arbeite ich daneben an so vielen unbezahlten Projekten mit, wie ich kann – egal ob in der Schweiz oder im Ausland.
Sie haben selbst einige Jahre im Saanenland gelebt. Was verbindet Sie heute noch mit dem Saanenland?
Das Saanenland ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben. Ich war von 2007 bis 2010 journalistisch für den «Anzeiger von Saanen» tätig. Ich bin aber auch danach immer wieder zurückgekommen, um meine dortigen Freundinnen und Freunde zu besuchen. Das letzte Mal war ich im Januar 2020 zu einem Besuch in der Schweiz. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, denn ich bekomme bis heute immer wieder Zuschriften und Mails aus dem Saanenland. Zum Beispiel von Leuten, die meinen Blog auf www.maron.ch lesen. Das Saanenland war für mich eine sehr schöne Station auf meiner Lebensreise.
ZUR PERSON
Nicole Maron wurde 1980 in Zürich geboren. Sie studierte in Bern (Islamwissenschaften, interreligiöse Studien) und in Zürich und Berlin (Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaften). Seit 2017 lebt und arbeitet sie in Bolivien und Peru. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit sind umwelt- und sozialpolitische Themen wie Flucht und Migration, globale Gerech tigkeit, Dekolonisierung und Menschen rechte. 2019 veröffentlichte Nicole Maron ihr drittes Buch mit dem Titel «Daphne und die Sonne – eine uralte Geschichte von Liebe und Tod», 2014 ihr zweites Buch «Mutter, hab keine Angst – die Geschichte von Zerins Flucht» und 2010 ihr erstes Buch über ihren Grossvater «Fritz Maron – ein Leben für Arosa».
Von 2007 bis 2010 arbeitete Nicole Maron als Journalistin/Redaktorin beim «Anzeiger von Saanen» und von 2008 bis 2011 war sie Mediensprecherin des Gstaad Film-Festivals.
KEREM S. MAURER
www.maron.ch
AUSZUG AUS DEM OFFENEN BRIEF AN BUNDESRAT IGNAZIO CASSIS, VORSTEHER DES EIDGENÖSSISCHEN DEPARTEMENTS FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN (EDA)
Lieber Herr Cassis
Im Dezember haben Sie bekannt gegeben, dass NGOs (Nichtregierungsorganisationen) künftig keine Gelder der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) mehr für Kampagnen und Sensibilisierungsarbeit einsetzen dürfen. Möchten Sie verhindern, dass hierzulande bekannt wird, welche Schäden die Schweizer Politik und Wirtschaft im Ausland anrichten?
Das Katholische Medienzentrum hat die Problematik auf den Punkt gebracht: «Ein Hilfswerk darf zwar weiterhin afrikanische Bäuerinnen im Gewinnen von traditionellem Saatgut unterstützen, in der Schweiz aber keine Veranstaltungen mehr durchführen, die die Macht multinationaler Konzerne über die Landwirtschaft im südlichen Afrika beleuchten.» Im Antwortschreiben wird festgehalten, dass die Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit weiterhin über globale Herausforderungen berichten dürfen, entsprechende Veranstaltungen oder Berichte jedoch aus privaten Spenden finanziert werden müssen. Damit soll sichergestellt werden, «dass die DEZA-Programmbeiträge für die Armutsbekämpfung und Förderung der nachhaltigen Entwicklung in den Entwicklungsländern investiert werden».
Doch hier liegt der Denkfehler. Der Ansatz «Armut vor Ort bekämpfen» ist genauso illusionär und arrogant wie die Forderung «Fluchtursachen vor Ort bekämpfen». Denn die Gründe für Armut und soziale Ungleichheiten in den Entwicklungsländern liegen nicht primär in der Unfähigkeit oder Korruptionsanfälligkeit der dortigen Regierungen, sondern in den globalen Strukturen, die bis heute auf einem Modell der Ausbeutung aufbauen. Genau dies wollte die Konzerninitiative aufzeigen und verändern.
Die Schweiz muss Verantwortung übernehmen. Und dazu reicht es nicht, sich zur Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele der UNO zu verpflichten oder das Pariser Klima-Abkommen zu unterzeichnen. Es kann nicht sein, dass die Strategie der Entwicklungspolitik darin besteht, die globalen Zusammenhänge und die eigene – negative – Rolle darin zu verbergen. Ich wünsche mir einen Bundesrat, der Verantwortung übernimmt und Ethik über wirtschaftliche Interessen stellt.
Nicole Maron, Kolumne in «Zeitpunkt»