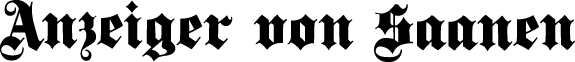«I mechis wieder!»
13.02.2026 InterviewSeit 1993 hat Markus Iseli die Gemeindeverwaltung in Saanen mitgeprägt und dabei zahlreiche Systemwechsel miterlebt. Nun geht der ehemalige Gemeindeschreiber und spätere Abteilungsleiter für Bildung, Soziales und Sicherheit in Pension. Im Interview spricht er über ...
Seit 1993 hat Markus Iseli die Gemeindeverwaltung in Saanen mitgeprägt und dabei zahlreiche Systemwechsel miterlebt. Nun geht der ehemalige Gemeindeschreiber und spätere Abteilungsleiter für Bildung, Soziales und Sicherheit in Pension. Im Interview spricht er über seine Kraftquellen und über Gemeindeversammlungen, die ihn ins Schwitzen gebracht haben.
JONATHAN SCHOPFER
Am 6. Dezember 1992 wurden Sie als Gemeindeschreiber gewählt. Können Sie sich an diesen Tag erinnern?
Ich war natürlich gespannt wie eine Feder. Gleichzeitig war es ein Sonntag, sogar ein Samichlaustag. Ich war aber nicht wie üblich als Chlaus unterwegs, sondern wir waren zu Hause, en famille. Wir haben Spiele gemacht und versucht, die Zeit etwas verstreichen zu lassen. Die Auszählung hat damals länger gedauert, weil die Stimmbeteiligung wegen der gleichzeitigen EWR-Abstimmung sehr hoch war. Als dann das Resultat feststand, war das natürlich ein grosser Moment. Rückblickend war die Wahl ganz klar ein Wendepunkt in meinem Leben. Und ehrlich gesagt, habe ich nicht damit gerechnet, bereits im ersten Wahlgang gewählt zu werden. Nachher wurden wir ins Rössli eingeladen. Der Jodlerclub hat dort gesungen, und der Abend bekam einen feierlichen Rahmen.
War für Sie von Anfang an klar, sich als Gemeindeschreiber aufstellen zu lassen?
Nein, ich dachte beim Erscheinen des ersten Inserates im Frühling, die Flug- und die damit verbundene Fallhöhe sei zu hoch für mich. Aber im August nach einer Sitzung der Schulkommission, kam Bethli Küng auf mich zu und fragte, ob ich noch fünf Minuten Zeit hätte. Sie erklärte mir, dass auf die Ausschreibung als Gemeindeschreiber zu wenig Bewerbungen eingegangen seien und der Gemeinderat nun aktiv geeignete Personen anspreche. Ob ich mir vorstellen könne, mich zu bewerben, fragte sie mich und gab mir eine Woche Bedenkzeit. Das war eine kurze Frist, mitten in einer Phase, in der ich mich voll auf das neue Schuljahr vorbereitete. Ich habe mich mit meiner Frau besprochen. Gleichzeitig erfuhr ich, dass ich für eine Kandidatur einen Wahlvorschlag mit rund zehn Unterschriften benötigen würde und dass dieser von der Behörde organisiert würde. Das war für mich eine wichtige Voraussetzung. So kam es, dass ich ohne eigenen Wahlkampf zusammen mit zwei weiteren Kandidaten zur Wahl antrat.
Und Sie wurden gewählt. Wie haben Sie den Einstieg ins Amt erlebt?
Rückblickend muss ich sagen: Der Zeitpunkt war nicht ideal. Ich hatte eine junge Familie. Und ich war Lehrer, also brauchte ich eine fachliche Ausbildung. Das habe ich im Vorfeld mit dem Gemeinderat klar besprochen. Es gab den Gemeindeschreiberkurs, den ich parallel zur Arbeit absolvierte. Das war für mich eine Bedingung. Ich wollte fachliche Kompetenz und damit auch als «Furthaariger» (Anm. der Redaktion: Zugezogener) die Akzeptanz beim Personal gewinnen.
Was beinhaltet der Gemeindeschreiberkurs?
Er beinhaltet: Rechtsgrundlagen aller Verwaltungsbereiche, Gemeinde-, Personal- und Verfahrensrecht, OR, ZGB, Kommunikation und Führung.
Können Sie sich an Ihren ersten Arbeitstag erinnern?
Mein Vorgänger, Peter Matti, stellte mich am ersten Arbeitstag morgens um 8 Uhr den Leuten vor und sagte sinngemäss: «Das ist der neue Chef.» Dann hat von der hintersten Reihe des Sitzungszimmers jemand gerufen: «Das muss er zuerst einmal beweisen!» Ich übernahm die Rolle sofort. Peter Matti arbeitete ab und zu noch im Archiv, half punktuell. Aber die Verantwortung lag von Anfang an bei mir. Ich erinnere mich an den ersten Arbeitstag – das Telefon klingelte. Peter Matti sagte: «Das ist dein Telefon.» Ich hob den Hörer ab und meldete mich als «Gemeindeschreiberei Saanen, Markus Iseli». Da realisierte ich: Jetzt ist es ernst.
Wie war die Arbeit in den ersten Jahren als Gemeindeschreiber organisiert?
Der Gemeindeschreiber war damals noch sehr stark die zentrale Figur der Verwaltung. Bei mir im Büro hing ein Kunstdruck von Albert Anker, der diese Rolle gut zeigt: «Der Gemeindeschreiber» mit der Feder im Mund, Papierstapel vor sich, fast wie ein Ankerpunkt der ganzen Verwaltung. Im Grunde lief fast alles Wichtige über meinen Tisch. Ich war Sekretär der Verwaltung, Sekretär des Gemeinderats und der Gemeindeversammlung. Ich bereitete die Sitzungen vor, protokollierte sie und unterzeichnete sämtliche Beschlüsse. Zum Glück hatte ich mit meinen Chefbeamtenkollegen Benz Hauswirth, Fritz Wampfler und Werner Reuteler eine unentbehrliche Hilfe.
Wie sah damals eine Arbeitswoche konkret aus?
Wir hatten jede Woche eine Gemeinderatssitzung, immer am Dienstagnachmittag. Die Sitzungen begannen nach dem Mittag und dauerten oft bis 18 oder 19 Uhr. Ich machte mir während der Sitzung Handnotizen. Am nächsten Tag war dann Diktiertag. Einen Computer hatte ich noch nicht. In meinem Büro stand eine Hermes-Schreibmaschine. Ich diktierte das Protokoll, meine Sekretärin Maya Brand tippte es anschliessend in ein Textverarbeitungssystem. Der Rhythmus war dicht: Mittwoch diktieren, Donnerstag Traktanden sammeln, Freitag Versand für die nächste Sitzung. Dazu kamen Beilagen, die kopiert und per Post verschickt wurden – jedes Gemeinderatsmitglied erhielt ein physisches Dossier.
Und am Anfang waren Sie noch in Kommissionen involviert?
Genau, ich war auch Sekretär der Vormundschafts- und Fürsorgekommission und der Polizei- und Gesundheitskommission. Auch dort schrieb ich Protokolle. Diese Arbeiten fielen oft ausserhalb der regulären Arbeitszeit an. Morgens früh, abends oder am Samstag. Abendsitzungen galten nicht als Arbeitszeit, es gab einfach ein Sitzungsgeld.
Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Es war intensiv, sehr intensiv. Aber für mich war klar: Ich habe mich für diese Aufgabe beworben, ich wurde von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern gewählt und diese Verantwortung zählte für mich mehr als das Zählen von Stunden. Ich hatte nie das Gefühl, dass meine Arbeit nicht wertgeschätzt wurde. Der Lohn entsprach in etwa meinem früheren Lehrerlohn und entwickelte sich später gut. Aber es war eine Phase, die viel Energie gekostet hat.
Gab es schon früh strukturelle Veränderungen?
Ja. Bereits per 1.1.1995 kam es zu einer wichtigen Veränderung. Damals war Leonz Blunschi Gemeinderatspräsident. Er stellte die Frage, ob wöchentliche Gemeinderatssitzungen erforderlich seien. Er hatte die Vorstellung, dass ein Gemeinderat eher wie ein Verwaltungsrat funktionieren sollte – strategisch, nicht operativ. Er nahm die Protokolle und strich mit dem Rotstift alles, was nicht auf diese Ebene gehörte. Schliesslich wurde entschieden, nur noch alle 14 Tage eine Gemeinderatssitzung abzuhalten. Das war ein markanter Einschnitt – und er gilt bis heute.
Was führte zur Verwaltungsreform 2007/2008?
Es wurde immer deutlicher, dass die Aufgabenfülle für eine einzelne Funktion zu gross wurde. Auch wenn ich die Ausbildung abgeschlossen hatte, war klar: Diese Kombination von Präsidialaufgaben, Fachressorts und strategischen Dossiers war langfristig nicht mehr tragbar. Mit der Reorganisation ab 2008 erhielt ich mehr zeitliche Ressourcen. Mit dem neuen Gemeinderatspräsidenten Andreas Hurni wurde deshalb eine grundlegende Reorganisation angegangen. Das Organigramm wurde angepasst. Es entstand die Funktion eines Verwaltungsdirektors, dazumal übernommen von Armando Chissalé, angelehnt an das City-Manager-Modell.
Was änderte sich dadurch für Sie?
Das war für mich ein eigentlicher Befreiungsschlag. Ich konnte das gesamte Präsidiale des Gemeindeschreibers abgeben. Stattdessen konzentrierte ich mich neu als Abteilungsleiter auf Bildung, Soziales und Sicherheit – mit eigenen Kommissionen und direkter Personalführung. Zudem blieben bei mir die Stellvertretung des Verwaltungsdirektors, die Lernendenausbildung und die partnerschaftlichen Projekte wie Darmstadt, internationale Schülerspiele und PowerstationArt.
Warum war diese Entlastung so wichtig?
Man muss ganze Themenpakete abgeben. Sonst bleibt man gedanklich immer im ganzen Spektrum drin. Diese klare Trennung hat es mir ermöglicht, wieder fachlich vertieft zu arbeiten und Verantwortung gezielt wahrzunehmen. Zum Beispiel beim Neubau des «Maison Claudine Pereira». In meiner Rolle als zuständiger Abteilungsleiter betreute ich administrativ Konzept und Planung. Als Geschäftsführer der Bauherrin Alterszentrum Saanen AG begleitete ich auch die Umsetzung – vom Wettbewerb bis zum Mietvertrag mit der Betreiberin Alterswohnen STS AG.
Zudem war aber auch klar: Die Gemeinde musste wachsen, auch personell.
Und 2025 gab es nochmals strukturelle Anpassungen?
Ja. Gegen Ende meiner Laufbahn wurde deutlich, dass die Ansprüche und die Komplexität erneut gewachsen waren. Bereits ab 2022 habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie ich meine Funktion übergeben kann. Das damalige Anforderungsprofil war sehr breit, der Arbeitsmarkt für Kaderstellen in der Verwaltung ist bekanntlich schwierig. Deshalb wurde eine weitere Organisationsentwicklung angestossen, die OE 2024, welche die ganze Verwaltung umfasste. Diese führte zu einer stärkeren Spezialisierung der Abteilungen. Aus einer Funktion wurden mehrere. Ich bin bis heute überzeugt, dass dieser Schritt richtig war – auch wenn er nicht unumstritten war.
Wie erlebten Sie die Gemeindeversammlungen?
Die Gemeindeversammlungen waren – und sind – ein zentrales Element der Demokratie. Viermal im Jahr organisierte ich sie zusammen mit dem Sekretariat. Einladung, Erläuterungen, Präsentationen, Ablauf, Protokoll, Medienbericht – alles lief über diese Struktur. Gerade dort zeigte sich immer wieder: Ohne Team wäre das alles nicht möglich gewesen. Das wird manchmal vergessen. Aber es war immer eine Teamarbeit. Die Gemeindeversammlungen waren oft anspruchsvoll. Gerade bei grossen, komplexen Geschäften konnten die Versammlungen bis nach Mitternacht dauern. Es gab viele Wortmeldungen, viele Anträge. Für den Versammlungsleiter ist das eine grosse Herausforderung. In solchen Situationen war es wichtig, dass er sich auf den Sekretär verlassen konnte. Wenn Unsicherheit bestand, wurde die Versammlung auch mal unterbrochen, und wir berieten gemeinsam: Wie bringen wir das rechtlich korrekt zur Abstimmung?
Was ist überhaupt zulässig respektive fällt in die Zuständigkeit der Gemeindeversammlung?
Welche Dossiers haben Sie in all den Jahren besonders stark gefordert?
Dazu gehörten ganz klar die Raumplanung, die Bergbahnen, Schulschliessungen und später die Spitalversorgung. Das sind Themen, die emotional sind, wirtschaftlich relevant und politisch heikel. Diese Dossiers lassen sich nicht einfach innerhalb eines Ressorts abhandeln. Sie sind oft ressortübergreifend, betreffen mehrere Gemeinden, private Partner, den Kanton – und am Ende immer auch die Bevölkerung.
Beginnen wir mit der Raumplanung.
Als ich 1993 anfing, lief bereits eine grosse Raumplanungsrevision. Ich habe damals Dutzende von Einspracheverhandlungen protokolliert. Das war eine sehr intensive Phase. Die Raumplanung ist besonders anspruchsvoll, weil sie tief in Eigentumsrechte eingreift. Jeder Entscheid hat direkte Auswirkungen auf Einzelne. Gleichzeitig ist der rechtliche Rahmen eng, vorgegeben durch Kanton und Bund.
Und die Bergbahnen. Warum war dieses Thema so anspruchsvoll?
Bei den Bergbahnen gab es lange Zeit verschiedene Trägerschaften für einzelne Berge. Jede hatte ihre eigenen Interessen. Als die Frage aufkam, ob diese Strukturen zusammengeführt werden sollen, führte das zu starken Spannungen. Es gab unterschiedliche Lager in der Bevölkerung. Das Wort Spaltung ist vielleicht zu stark, aber es hat klar polarisiert. Gerade bei Verträgen mit mehreren Partnern kann man nicht einfach an einer Gemeindeversammlung beliebige Änderungsanträge zulassen. Das ist für viele schwer verständlich.
Und die Schulschliessungen?
Diese greifen tief in Kultur und Tradition unserer Bäuerten ein und verändern etwas, das doch bisher immer gut funktioniert hat. Der Rückgang der Schülerzahlen und die vom Kanton geforderten Mindest-Klassengrössen liessen uns aber keine andere Wahl. Die an Info-Veranstaltungen in den Bäuerten und an der Gemeindeversammlung geäusserte Opposition ging mir unter die Haut. Die Beschlüsse an der GV fielen zu Beginn ein erstes Mal negativ (Abländschen) oder unentschieden aus (Chalberhöni). Erst etwas später fand sich für das Unvermeidbare die nötige Mehrheit. Heute sind von ursprünglich elf noch sieben Schulhäuser in Betrieb.
Wie haben Sie die Spitalversorgung erlebt?
Die Spitalversorgung war eines der emotionalsten Dossiers. Hier ging es nicht nur um Strukturen oder Finanzen, sondern um Sicherheit, Nähe und Vertrauen. Eine Person aus Gästekreisen sagte mir einmal: Wenn ich in meinem Land ein Spital bauen will, dann baue ich eines. Sie konnten nicht verstehen, warum das in der Schweiz – und insbesondere im Kanton Bern – so nicht funktioniert. Ich musste ihm erklären, dass die Spitalplanung kantonal geregelt sei, dass es raumplanerische, eigentumsrechtliche, betriebliche, personelle und finanzielle Fragen gebe, die man nicht einfach ausblenden könne. Das war anspruchsvoll, vor allem wenn Menschen mit viel Engagement und auch viel Geld dahinterstanden.
Gab es in dieser Zeit schlaflose Nächte?
Nicht die inhaltlichen Lösungen haben mir schlaflose Nächte bereitet. Ob ein Projekt am Ende angenommen oder abgelehnt wird, gehört zur Demokratie. Was mich beschäftigte, war das Verfahren. Machen wir es richtig? Sind wir rechtlich korrekt unterwegs? Besteht das Risiko von Einsprachen oder Beschwerden? Fehler im Verfahren können Projekte massiv verzögern und viel Geld kosten. Das wollte ich unbedingt vermeiden. Vor diesen grossen Gemeindeversammlungen war ich oft nervös. Ich las am Schluss jeweils selbst das Protokoll. Bei Versammlungen mit über 800 Personen – etwa in der Tennishalle – dauerte das zuweilen bis nach 1 Uhr. Die Verantwortung war spürbar, da kam ich schon ins Schwitzen.
Anders empfand ich die emotionale Belastung, wenn es um unmittelbar lebensnahe Themen ging, z.B. bei Personalausfällen, bei sozialen Härtefällen, bei der Unterbringung von Asylpersonen, der Wohnraumproblematik, der gesundheitlichen Grundversorgung, aber auch bezüglich der Bewältigung ausserordentlicher Ereignisse wie Corona, Unwetter oder Stromausfall. Da vertraute ich noch mehr als sonst auf die Zusammenarbeit im Team – alleine ist man dem nicht gewachsen. Den tollen Kolleginnen und Kollegen kann ich nicht genug danken!
Wie sind Sie mit der Verantwortung umgegangen?
Ich habe versucht, mich nicht von der Lautstärke oder von Einzelinteressen leiten zu lassen. Entscheidend war für mich immer das öffentliche Interesse. Wir von der Gemeinde arbeiten für die Bevölkerung – nicht umgekehrt! Man kann es nie allen recht machen. Aber wenn die grosse Mehrheit mit einem Entscheid leben kann, dann ist viel erreicht. Das bedeutet auch, dass jede Seite ein Stück nachgeben muss.
Hat die Komplexität der Themen und der Druck auf die Verwaltung in den letzten Jahren eigentlich zugenommen?
Ja, in Saanen gibt es viele Menschen mit Ideen, Einfluss und finanziellen Möglichkeiten. Das ist eine Chance, aber auch eine Herausforderung. Wenn Projekte nicht so schnell vorankommen wie gewünscht, steigt der Druck. Dann stehen plötzlich Anwälte im Raum. Das ist nicht neu, hat aber in den letzten Jahren zugenommen.Für die Gemeinde bedeutet das, dass man fachlich und rechtlich sauber arbeiten muss. Fehler werden ungern verziehen.
Wie haben Sie Opposition und kritische Stimmen erlebt?
Opposition ist manchmal unangenehm, aber sie ist auch hilfreich. Sie zeigt auf, woran man noch denken muss, welche Alternativen es gibt. Sie zwingt einen dazu, genauer hinzuschauen. Demokratie lebt auch davon, dass man widersprochen wird – vom Dialog. Wichtig ist aber, dass dieser frühzeitig einfliessen kann – nicht erst dann, wenn ein Geschäft schon fast abgeschlossen ist.
Was war Ihnen bei all diesen grossen Dossiers besonders wichtig?
Sachlich bleiben, zuhören, erklären. Die Gemeindeversammlung ist dafür ein wichtiges Gefäss. Wenn man die Spielregeln einhält, formell korrekt bleibt und respektvoll miteinander umgeht, dann trägt die direkte Demokratie auch schwierige Entscheide. Ich bin daher fest überzeugt: Gerade in einer Bergregion wie Saanen, wo man aufeinander angewiesen ist, ist dieses Zusammengehörigkeitsgefühl entscheidend.
Nach 33 Jahren bei der Gemeindeverwaltung Saanen steht nun wieder ein Wandel an: die Pensionierung. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf?
Es gibt für mich zwei Ebenen. Die eine ist das, was sich nicht verändert. Das ist meine Verwurzelung in der Gemeinde. Ich habe das Gefühl, hier wirklich angekommen zu sein. Das bleibt, und das gibt mir Boden und Kraft. Die andere Ebene ist die Veränderung. Es fällt sehr viel weg. Der berufliche Alltag, die Verantwortung, das ständige Mitdenken. Aber ich kann gut loslassen. Ich weiss, dass die Aufgaben in guten Händen sind, und das erleichtert vieles.
Gibt es Aspekte Ihrer Arbeit, die Sie vermissen werden?
Vielleicht das kollegiale Miteinander. Die Begegnungen, auch ausserhalb der Sitzungszimmer – etwa an Skitagen oder bei gemeinsamen Anlässen. Das hat geholfen, einander besser zu verstehen, nicht nur als Funktionsträger, sondern als Menschen. Es war eine gute Zeit, aber sie darf jetzt auch zu Ende gehen.
Wie bereiten Sie sich auf diese neue Lebensphase vor?
Vor allem innerlich. Die Frage ist weniger: Was mache ich morgen? Sondern: Wie gehe ich mit der Zeit um? Ich habe jetzt mehr Zeit, und das ist zunächst ungewohnt. Ich habe eine Enkelin, bald kommt eine zweite dazu. Darauf freue ich mich sehr. Ich möchte präsent sein, ohne Leistungsdruck. Einfach da sein.
Haben Sie konkrete Pläne?
Ich möchte etwas Dienliches tun. Das Wort klingt vielleicht etwas altmodisch, trifft es für mich aber gut. Etwas tun, das nicht nur mir dient, sondern einem grösseren Ganzen. Ich möchte mir die Agenda nicht vollschreiben. Ich möchte singen, in der Natur unterwegs sein, die Gegend bewusster erleben – zu Fuss, mit dem Velo, mit dem «Cämperli». Ich möchte mehr Zeit haben für Dinge, die liegen geblieben sind.
Wie wichtig ist Ihnen dieser offene Zugang?
Sehr. In meinem Leben sind die guten Dinge oft zu mir gekommen, ohne dass ich sie aktiv gesucht habe – beruflich wie privat.
Gab es auch emotionale Momente im Hinblick auf die Pensionierung?
Ja. Die Vorstellung, plötzlich sehr viel Zeit zu haben, kann auch verunsichern. Das ist nicht nur positiv. Es braucht ein gutes Selbstmanagement. Ich nehme mir bewusst Zeit für den Abschluss. Auch dieses Interview ist Teil davon. Es hilft mir, zurückzublicken und Dinge abzuschliessen. Und mir ist bewusst: Mit der Pensionierung beginnt mein letzter Lebensabschnitt.
Was gibt Ihnen Kraft und Orientierung?
Drei Dinge. Erstens die Dankbarkeit für das Leben und die eigene Gesundheit. Ich empfinde den menschlichen Körper und das Leben, die Schöpfung, als grosses Wunder. Das Zweite ist Christus. Für mich ist er ein zentraler Halt, eine Kraft- und Hoffnungsquelle und auch eine Quelle des Vertrauens. Gerade angesichts von traurigen Geschehnissen in dieser Welt, Himmelfahrtskommando, Weltuntergangsstimmungen oder auch nach Angstträumen weiss man nicht immer, wie man damit umgehen soll. Ich halte mich an die Vorstellung, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Dass dieses Leben eine Etappe ist – fast wie ein Trainingslager hier auf der Erde. Eine Zeit, um zu lernen, sich zu entwickeln und zu dienen. Und das Dritte ist für mich die tägliche Begleitung durch meinen Schutzengel. Ich bin fest überzeugt, dass er mit mir unterwegs ist. Ich nenne das auch Intuition. Manchmal sind es Gedanken oder Ideen, bei denen ich spüre: Die kommen nicht einfach aus dem Bauch heraus. Ich darf mich auf einen Beistand verlassen, der auch im Alltag, auch auf der operativen Ebene, mit mir unterwegs ist.
Das sind drei Faktoren, aus denen ich Mut und Kraft schöpfe. Auch wenn es mich manchmal «fascht glüpft het» (hält ergriffen inne). Uff, entschuldigen Sie, jetzt werde ich noch emotional.
Es zeigt, wieviel Ihnen das Thema bedeutet.
Und natürlich: Ohne meine Frau Stephanie wäre vieles nicht möglich gewesen. Sie hat die Herausforderung angenommen, wusste aus ihrer eigenen Familiengeschichte, was ein öffentliches Engagement bedeutet. Rückblickend sehe ich noch klarer, wie viel sie geleistet hat. Als ganze Familie haben wir diese Zeit getragen und überstanden.
Bereuen Sie manchmal, dass Sie so lange in der Gemeindeverwaltung gearbeitet haben?
Natürlich gab es schwierige Tage. Aber ich muss sagen: Jeder Tag war auf seine Art spannend. Ich hatte immer ein «Ja» zum Beruf – und deshalb kann ich heute sagen: «I mechis wieder!»
Wenn man in 20 Jahren auf Ihre Zeit als Gemeindeschreiber zurückblickt: Wofür möchten Sie in Erinnerung bleiben?
Als jemand, der versucht hat, Konflikte zu entschärfen und zu Lösungen zu führen, die für möglichst viele tragbar sind. Friedliebend, vielleicht auch etwas harmoniesüchtig – ja, das gehört dazu. Während politische Ämter wechseln, bleibt die Verwaltung bestehen und mit ihr auch eine gewisse Haltung. Ich wollte Eskalationen vermeiden und zur Schlichtung beitragen. Wenn von dieser Haltung etwas geblieben ist, dann wäre das für mich das Schönste.
ZUR PERSON
Markus Iseli wurde am 11. Februar 1961 in Solothurn geboren. Seine schulische Laufbahn führte ihn über Solothurn und Günsberg ans Gymnasium in Solothurn, anschliessend absolvierte er 1976 das Lehrer:innenseminar in Spiez. 1980 trat Markus Iseli seine erste Stelle als «Schuelmeischter» an der Oberschule Bissen an. 1990 schloss er die Ausbildung zum Katecheten der reformierten Landeskirche Bern-Jura ab.
1992 folgte der berufliche Wendepunkt mit der Wahl zum Gemeindeschreiber von Saanen an der Urne. Im Sommer 1993 trat er die Stelle offiziell an, 1997 erlangte er das Diplom als Gemeindeschreiber. In den folgenden Jahrzehnten prägte er die Gemeindeverwaltung wesentlich mit. Ab 2008 wirkte er als Abteilungsleiter Bildung, Soziales und Sicherheit sowie als stellvertretender Verwaltungsdirektor. Nach 33 Jahren im Dienst der Gemeindeverwaltung Saanen tritt Markus Iseli 2026 in den Ruhestand.
Parallel zu seiner zivilen Laufbahn engagierte sich Markus Iseli im Militär. Nach der Rekrutenschule als Flieger-Nachrichtensoldat durchlief er verschiedene Kaderausbildungen. Zuletzt war er als Identifikationsoffizier in der Einsatzzentrale der Luftverteidigung tätig und wurde 2011 im Rang eines Majors verabschiedet.
Privat ist Markus Iseli seit 1989 mit Stephanie Matti verheiratet. Sie haben zwei Töchter, Rebekka Katharina und Sarah Luisa. Seit 2024 sind sie Grosseltern von Elvine.
Ausgleich findet Markus Iseli beim Wandern, Ski- und Velofahren, Yoga und Schwimmen. Zudem ist er unter anderem aktives Mitglied im Jodlerklub «Gruss vom Wasserngrat» und im Rotary Club Gstaad-Saanenland. Einer seiner Leitsätze stammt vom Apostel Paulus: «Prüfet alles, behaltet das Gute.»
JSC