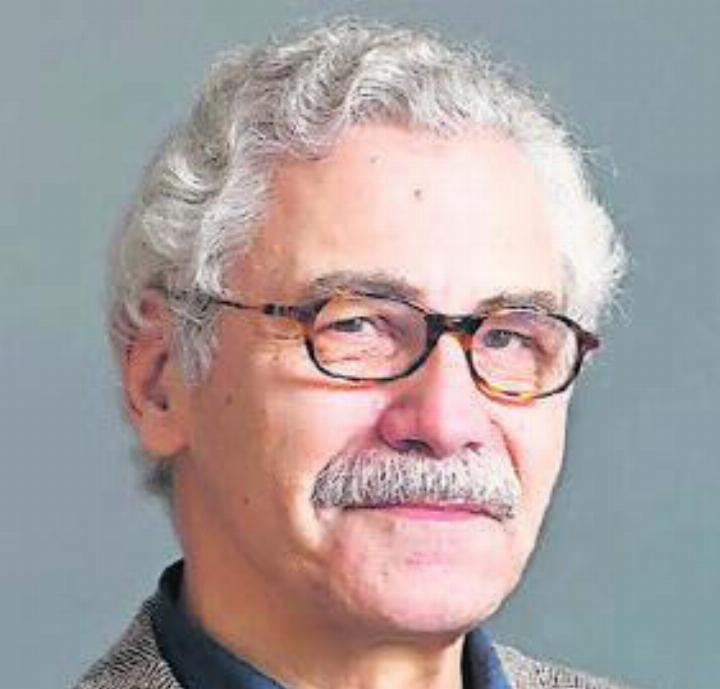Ungerechte Schweiz
31.03.2023 KolumneUnser Land gilt allgemein als Sozialstaat. Denn in der Bundesverfassung finden sich die Sozialziele. Artikel 41 enthält davon sieben und das erste lautet: «Bund und Kantone setzen sich … dafür ein, dass: a. Jede Person an der sozialen Sicherheit teilhat.» Darauf folgen die gesundheitliche Pflege, der Schutz und die Förderung der Familie, die Arbeit zu angemessenen Bedingungen für Erwerbsfähige, eine geeignete Wohnung zu tragbaren Bedingungen für Wohnungssuchende und ihre Familien, die Aus- und Weiterbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie deren Entwicklung zu selbstständigen und sozial verantwortlichen Menschen. Die Aufzählung schliesst damit, dass alle Personen «in ihrer sozialen, kulturellen und politischen Integration unterstützt werden sollen.» Alle diese Absichten haben ihre Grundlage nicht zuletzt in der revolutionären Forderung im Frankreich von 1789: «Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.» Das war einmal. Die Ungleichheit in der Schweiz – das ist das Thema im eben erschienenen Caritas-Sozialalmanach 2023. Wer wissen will, wie es in der Praxis um die Sozialpolitik hierzulande bestellt ist, dem sei die Lektüre empfohlen. Hier liest man etwa, wie Ungleichheit etwas zu tun hat mit dem Umstand, dass grosse Vermögen kaum angemessen besteuert werden. Das ist wohl mit ein Grund dafür, dass einige der weltweit grössten Vermögen in die Schweiz flüchten. Aber erst in den Siebzigerjahren setzte hier eine Entwicklung zu etwas mehr Verteilungsgerechtigkeit ein: Die AHV-Renten wurden verdoppelt und die Beiträge entsprechend angepasst. Und weltweit erfolgte dann ab 1980 die neoliberale Wende. Es war die Zeit der Deregulierung der Arbeitsmärkte. Angeblich ineffiziente Normen und ordnungsrechtliche Vorschriften, aber auch Marktzutrittsbeschränkungen wurden abgebaut. Diese Entwicklung ging einher mit Sozialabbau, Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen sowie mit Steuersenkungen für Unternehmen, hohe Einkommen und Vermögen. Der Soziologe Ueli Mäder zeigt hier auf, wie sich in diesem Kontext die Schere zwischen Armut und Reichtum immer weiter öffnete. Er spricht sogar von einer «Refeudalisierung der Schweiz», in der wenige reiche Familien unmässig viel Einfluss auf Politik und Gesellschaft ausüben. Dazu gehören die Erkenntnisse der Sozialwissenschafter Robert Fluder, Hans Baumann und Rudolf Farys. «Immer mehr Reichtum für Wenige» gebe es in der Schweiz. Hier werde die Konzentration grosser Vermögen immer extremer. Damit würden wichtige Investitionen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Klimaschutz nicht getätigt. Warum? Weil grosse Vermögen über die Finanzindustrie risikoreicher angelegt werden und längerfristig höhere Renditen erzielen. Ein solcher Mechanismus produziert geradezu Ungleichheit und sie bedroht neben der wirtschaftlichen Entwicklung sogar die direkte Demokratie. Die Autoren weisen darauf hin, dass neben den hohen Einkünften immer mehr die Erbschaften die Ungleichheiten produzieren. Der Anteil der jährlichen Erbschaften von fünf Prozent des Volkseinkommens in den Fünfzigerjahren sei auf 13 Prozent in den 2010er-Jahren gestiegen, schreiben die Autoren. Hinzu komme, dass sich die Vermögensungleichheit zu einem staatspolitischen Problem entwickle. So könnten heute «Volksabstimmungen von einzelnen Vermögenden lanciert (Beispiel: Justizinitiative) und Abstimmungen mit kostspieliger Propaganda beeinflusst werden». Eine solche Art von Usurpation finde sich auch bei den sogenannten sozialen Medien wie Facebook, Twitter oder Instagram, welche von wenigen Superreichen kontrolliert würden. Daraus ergibt sich der verheerende Schluss: Mit mehr Geld hat man mehr Macht in einer letztlich absurden Demokratie.
Die unbarmherzige Bilanz von Caritas Schweiz ist niederschmetternd. Zwar liest man auf der zweitletzten Seite noch den Zwischentitel: «Eine andere Welt ist möglich.» Aber der Hinweis auf das Engagement für die «Uno-Agenda 2030» reicht da bei Weitem nicht aus.
Wir alle müssen viel mehr tun – für eine andere Schweiz.
OSWALD SIGG
JOURNALIST, EHEMALIGER BUNDESRATSSPRECHER
oswaldsigg144@gmail.com