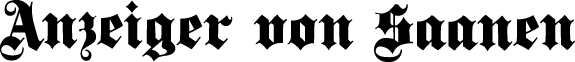«Qualitativ sind wir Quantensprünge weiter als die Agglomerationsgemeinden»
08.05.2018 Saanen, InterviewThomas Frutschi ist seit sieben Monaten Bauverwalter in Saanen. Im Interview spricht er über den Baustil, die Herausforderungen, das Zeitmanagement usw.
ANITA MOSER
Thomas Frutschi, haben Sie das Saanenland gekannt?
Ja. Mein Lehrbetrieb hat damals das Hotel Steigenberger geplant. Als Hochbauzeichnerlehrling durfte ich die Detailpläne zeichnen. Später habe ich noch drei Chalets in Rougemont gezeichnet. Und ich hatte während der Lehrzeit einen guten Freund in Saanenmöser. Mit ihm war ich oft Skifahren in der Region.
Fühlen Sie sich wohl im Saanenland?
Ja, sehr.
Sie haben bisher am Bielersee gewohnt. Fehlt Ihnen der See?
(schmunzelt) Es gibt ja den berühmten «Louenesee» und den Arnensee. In Saanen fehlt der See tatsächlich, den es offenbar einst gab … Aber es braucht ja nicht überall alles. Das Saanenland hat eine schöne Ausprägung mit der Landschaft und mit den Siedlungsbildern. Es braucht also nicht auch noch einen See.
Saanen sei für einen Bauverwalter sehr interessant, sagte ihr Vorgänger. Stimmen Sie dem zu?
Ja, das kann ich bestätigen. Saanen hat zusätzlich zu den Geschäften, wie man sie im Kanton Bern zum Beispiel bei Baubewilligungen und Raumplanungen abwickelt, die Zweitwohnungsthematik oder alpine Themen. Diese sind für mich neu. Ich habe vorher im Unterland gearbeitet in Kernstädten und Agglomerationsgemeinden. Dort sind die Ausprägungen anders.
In welcher Hinsicht?
Eine Kernstadt hat meistens Vollzeitpolitiker, die präsent sind, während in Agglomerations- oder ländlichen Gemeinden diese Ämter häufig ehrenamtlich ausgeführt werden. Das ist ein ganz anderes Arbeiten. In einer Kernstadt ist die Verwaltung sehr professionell aufgebaut und aufgeteilt in Abteilungen. Das Bauinspektorat ist nicht in der gleichen Abteilung wie das Hochbauamt, auch nicht in der gleichen Abteilung wie das Stadtplanungsamt und die Stadtgärtnerei ist wieder eine andere Abteilung. Und überall sind Fachleute verantwortlich. In kleinen Gemeinden braucht man eher Allrounder und diese haben in der Regel eine Verwaltungsausbildung. Sie müssen sich die Fachthemen wie Hochbau, Tiefbau oder Ingenieurwesen aneignen oder extern einkaufen. Von dem her gibt es organisationsformbedingt grosse Unterschiede.
Und welche noch?
Im Erscheinungsbild. Mir ist räumliche Qualität ein hohes Anliegen. In Kernstädten ist dies viel einfacher zu generieren. Man hat die Fachleute, zum Beispiel eine Stadtbildkommission, welche qualitätssichernd wirkt. Das hat man in aller Regel in Agglomerationsgemeinden nicht.
Mangelt es in Saanen an der räumlichen Qualität?
Hier hat man sich vor langer Zeit auf einen Baustil geeinigt. Das war für die bauliche Entwicklung ein ganz wichtiger, strategischer Entscheid. Der – wie ich bisher festgestellt habe – von allen getragen wird. Es gibt keinen Architekten, der sich diesem Entscheid explizit widersetzt.
Aber der eine oder die andere würde sicher gerne «freier» und «moderner» planen und bauen.
Ja, es gibt Differenzen. Aber es ist ein Esprit vorhanden – so nehme ich es zumindest wahr –, diesen Raum sorgfältig und in einem einheitlichen Erscheinungsbild zu gestalten. Das finde ich fantastisch und macht mir sehr grosse Freude. Diesbezüglich ist das Saanenland qualitativ Quantensprünge weiter als die Agglomerationsgemeinden.
Ihr Vorgänger hat als grösste Herausforderungen unter anderem die Umsetzung des eidgenösssichen Raumplanungs- und des Zweitwohnungsgesetzes genannt. Die Gesetze werden zwar angewandt, aber das Controlling müsse noch aufgegleist werden.
Ja, die operative Umsetzung des Controllings wird uns noch ein paar Tage beschäftigen.
Was sind aus Ihrer Sicht die grössten Herausforderungen für die Gemeinde?
Es gibt meiner Ansicht nach – ich bin ja Städter – eine sehr spannende Alpwirtschaft. Ich habe verstanden, dass Saanen drei Standbeine hat: die Landwirtschaft, das Gewerbe und den Tourismus. Es ist eine spannende Frage, wie sich Saanen, die Marke Gstaad, vor dem Hintergrund des Zweitwohnungsgesetzes und den globalen Veränderungen – vor allem was Mobilität und Klimawandel betrifft – in Zukunft positioniert.
Was ist in diesem Zusammenhang die Rolle der Bauverwaltung?
Ich verstehe mich als Dienstleister. Unsere Bauverwaltung soll auf der räumlichen Ebene und mit den räumlichen Mitteln dazu beitragen, die Gesamtstrategie der Gemeinde und der Marke Gstaad zu unterstützen. Ich vergleiche das Siedlungs- und Landschaftsbild im Saanenland gerne als Bühnenbild: Und wie bei einem Bühnenbild muss man versuchen, das Störende wegzunehmen und das Ganze so zu arrangieren, dass es «die Handlung des Stücks» unterstützt und möglichst nichts störend wirkt. Und das ohne gestylt zu wirken und ohne die Authentizität zu verlieren.
Als Hauptgrund für seinen Wegzug nannte Adrian Landmesser die hohe zeitliche Belastung. Wie gehen Sie damit um?
Im Moment kann ich nicht klagen. Am besten fragen Sie mich in sechs Jahren wieder …
Haben Sie Veränderungen vorgenommen?
Wir haben organisatorische Umstellungen gemacht, bei denen es mir um Effizienz und die Qualitätssicherung von Prozessen ging. Ich hoffe, die Gesuchstellenden merken mit der Zeit, dass es schneller und – hoffentlich – bereits im ersten Anlauf geht.
Welchen Führungsstil pflegen Sie?
Ich habe gleich zu Beginn die Kompetenzen im Team neu verteilt. Ich muss nicht die Kontaktperson zu jedem Baugesuch sein, dafür haben wir die Bauinspektoren. Das sind Fachleute, welche die Baugesuche selbständig bearbeiten können. Wir haben eine griffige Aufteilung vorgenommen: Michael Herrmann bearbeitet die Baugesuche innerhalb der Bauzone, Karla Katzer jene ausserhalb der Bauzone. Das habe ich den Architekten auch so mitgeteilt und es funktioniert gut. Selbstverständlich habe ich Kenntnis von allen Baugesuchen, aber die Bearbeitung überlasse ich meinem Team. In der Bauplanungskommission, wo alle Baugesuche behandelt werden, bin ich auch dabei.
In der Bevölkerung spricht man oft von ungleicher Behandlung der Baugesuchsteller. Zu Recht?
Nein. Rechtsgleiche Behandlung ist ein Verfahrensgrundsatz, an den wir uns halten. Und da spielt es keine Rolle, wie dick das Portemonnaie ist. Aber das Baugesetz ändert im Laufe von Jahrzehnten. Und so gibt es in jeder Gemeinde diesbezügliche Differenzen: Etwas, was früher möglich war, wird eingeschränkt oder verboten. Solche Entscheide sind aber unabhängig von der Klientel, sie sind auf die Anpassung von Baugesetz, Baureglement und weiteren Erlassen zurückzuführen.
Haben Sie auch Besprechungen morgens um 6 Uhr wie Ihr Vorgänger?
Ich probiere meine Work-Life-Balance zu halten. Selbstverständlich versuche ich es einzurichten, wenn mal eine Sitzungen am Abend anberaumt ist oder am Wochenende. Das ist klar. Man ist für die Bevölkerung da.
Wie gut kennen Sie die Region?
Bevor ich im Oktober angefangen habe, haben meine Frau und ich hier eine Woche Ferien gemacht und die Gegend erkundet. Und selbstverständlich nehme ich, wenn ein Thema aufkommt, einen Augenschein vor Ort. So kommt Stück für Stück zusammen. Ich bin tendenziell der visuelle Typ und verorte es auf meiner inneren Landkarte. Es ist mir schon wichtig, dass ich weiss, wo was ist und will nicht einfach abstrakt anhand von Plänen entscheiden, ohne den Kontext genau zu kennen.
Verstehen Sie den Saaner Dialekt?
Ja, ich denke schon, ich habe zumindest diesen Eindruck. Natürlich gibt es spezielle Ausdrücke, über die ich manchmal rätsle. Aber mit der Zeit lerne ich auch diese kennen und im Zusammenhang mit dem Satz ist ja meist nachvollziehbar, was gemeint ist.
Kennen Sie die Saaner Spezialitäten?
Ja, selbstverständlich und ich geniesse sie auch. Besonders liebe ich die lokalen Käsemutschli, die Fonduemischung und das Trockenfleisch. Saanensenf hingegen ist nicht so mein Ding …
Als Bauverwalter steht man im Fokus, in der Kritik. Wie gehen Sie damit um?
(lacht) Da müssen Sie andere fragen, wie «dieser Frutschi ohne a» ankommt. Bis jetzt ist noch nichts an mich herangetragen worden, das mich aus dem Gleichgewicht bringen würde. Im Gegenteil: Es ist mir wichtig, den Kontakt zu den Architekten zu pflegen. Ich habe sie zum Kennenlernen eingeladen, habe sie gefragt, ob Interesse bestehe für regelmässige Treffen und einen ungezwungener Meinungsaustausch. Das Echo war positiv. Inzwischen hat schon eine zweite Veranstaltung zum Thema «Kanalisationen» stattgefunden.
Ist eine weitere Veranstaltung geplant?
Ja, zur Thematik «Umgebungsgestaltung zwischen Chalet und Landschaft».
Ich würde gerne von den Architekten und Gartenplanern erfahren, was ihre Leitlinien sind, was ihnen wichtig ist und was aus ihrer Sicht in die Landschaft passt.
Als Sie angefangen haben, war Ihr Vorgänger schon weg, er konnte Sie also nicht einarbeiten. Sie sind 57-jährig – ist die Nachfolgeregelung ein Thema, denkt man, intern jemanden nachzuziehen?
Ich denke im Moment noch nicht an die Nachfolgeregelung. Dafür habe ich schon noch ein paar Jahre Zeit. Jetzt bin ich vorerst am «Umorganisieren» auf einen Level, den ich für eine so wichtige Gemeinde angemessen finde.
Sie waren Bauökologe beim Hochbauamt in der Stadt Biel. Können Sie hier von dieser Ausbildung profitieren?
Das ist schon sehr lange her. Damals war Bauökologie ein neues Thema und es brauchte spezialisierte Pioniere. Heute gehört Bauökologie zur Grundausbildung im Baugewerbe. Es gibt ja neben dem Minergie-Label auch das Minergie-Eco-Label, darin ist die bauökologische Thematik mitberücksichtigt. Oder nehmen wir das aktuelle Schürli-Thema: Wenn man sie mit natürlichen Materialien, mit traditionellen Baustoffen ausbaut, kommt das dem bauökologischen Verständnis schon sehr nahe.
Wie stehen Sie zur Schürli-Geschichte?
Wir überlegen uns, die Thematik von der Gemeinde her aufzugreifen. Allerdings muss man sich erst überlegen, was sinnvoll ist, welches Planungsinstrument es braucht und ob man Gesetze anpassen muss. Da wäre dann schon eher Lobbying auf Kantons- und Bundesebene notwendig und das ist für eine einzelne Gemeinde schon etwas schwierig. Die Schürli-Thematik ist ja im ganzen Alpenraum ähnlich – mit lokalen Ausprägungen. Hier sind sie aus Holz, dort aus Stein, hier nennt man sie «Schürli» oder «Stafel», dort «Rustico». Man müsste eher versuchen, zusammenzufinden und einen gemeinsamen Weg zu gehen. Und man muss sich angesichts der grossen Anzahl solcher Kleinstbauten auch fragen, wo man die Prioritäten setzt – landschaftlich, räumlich oder nutzungs- respektive erschliessungsmässig. Und wie ist es mit der Rechtsgleichheit? Sie sehen, es gibt Fragen über Fragen. Die Wichtigste: Was ist eine mögliche sinnvolle Nutzung? Es muss ja nicht in jedem Fall eine Wohnung sein. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Aber das ist eine politische Thematik. Ist der Landschaftsraum schöner, wertvoller mit oder ohne Schürli? Oder mit nur halb so vielen? Wie trifft man die Auswahl? Auch zerfallende Schürli können ihren Reiz haben. Im Maggiatal trifft man auf viele solche Ruinen – das hat etwas Malerisches.
Was Sie noch sagen wollten …
Ich finde es toll, dass man sich auf die Chaletarchitektur geeinigt hat und diese gemeinsam verfolgt – das Baureglement ist ja entsprechend detailliert. Gebäude sollen aber auch Stimmungen, Atmosphären erzeugen. Und dies lässt sich nicht in einem Baureglement festlegen. Also braucht es immer wieder die Leistung der Architekten, die reflektieren, was passt und richtig ist – auch wenn Dachneigung und Proportionen vorgeschrieben sind. Und es gibt schon noch gewisse Flecken, die besser gepflegt sein könnten. So stehen in Gewerbezonen andere Kriterien im Vordergrund als Ästhetik, dafür habe ich volles Verständnis. Aber man muss sich bewusst sein, dass auch Gewerbezonen von überall her einsehbar sind und die Wahrnehmung der Landschaft mitprägen. So hat zum Beispiel jemand, der hier Erholung sucht und das Pech hat, gegenüber einer Gewerbezone zu wohnen, wenig von der schönen Landschaft. In der Gewerbezone könnte man meiner Meinung nach noch etwas sorgfältiger umgehen mit dem wertvollen Gut Landschaftsraum – auch ohne grossen Aufwand. Das Bühnenbild – um darauf zurückzukommen – macht nicht an der Zonengrenze Halt.
ZUR PERSON
Thomas Frutschi ist Architekt HTL, Raumplaner FSU und hat das Bauverwalterdiplom. Zudem hat er ein Nachdiplom in Betriebswirtschaft. Zuletzt amtete er als Leiter Bau und Liegenschaften der ev.-ref. Gesamtkirchgemeinde Bern. Davor war er unter anderem Bauökologe beim Hochbauamt der Stadt Biel, war Leiter des Stadtbauamtes der Stadt Sursee und arbeitete in der Stadtentwicklung der Stadt Bern. Thomas Frutschi ist 57-jährig, verheiratet und wohnt seit Januar 2018 in Saanen, davor in Brügg am Bielersee. Aufgewachsen ist Thomas Frutschi in der Stadt Bern. Sein Heimatort ist Ringgenberg
PD/ANITA MOSER